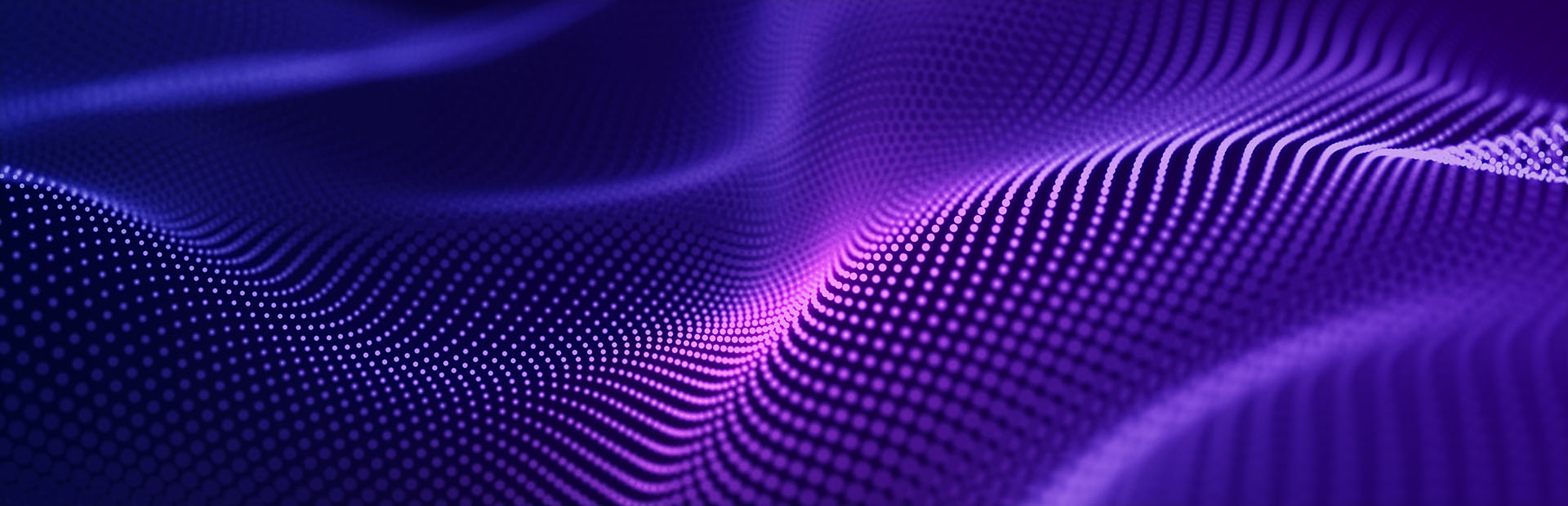Auswirkungen des Zulassungsrechts auf Psychotherapeut:innen

Autoren
Für eine Psychotherapie bestehen lange Wartezeiten. Je nach Region sind Wartezeiten von mehreren Monaten keine Seltenheit. Ob die Psychotherapie durch einen Psychiater oder einen Psychologen durchgeführt wird, ändert an den Wartezeiten wenig. Doch Wartezeiten von mehreren Monaten sind zu lang, wenn man leidet. Krankhafte Angst, eine Sucht oder eine Depression klingen nicht einfach so von selbst wieder ab wie eine Erkältung oder ein Magen-Darm-Infekt. Im Gegenteil. Seelische Erkrankungen werden mit der Zeit schlimmer und enden chronisch, was hohe Folgekosten verursachen kann.
Gefährdete Versorgungssicherheit
Die langen Wartezeiten stehen in Widerspruch zum Ziel, dass der Bundesrat mit dem kürzlich vollzogenen Wechsel vom Delegations- zum Anrechnungsmodell verfolgt hat. Durch die Aufwertung der psychologischen Psychotherapie sollten die Wartezeiten für Patientinnen und Patienten verkürzt werden, die auf eine Psychotherapie angewiesen sind, die über die Krankenkassen abgerechnet werden kann.
Die neuen Bestimmungen über die Zulassung von ambulanten Leistungserbringern laufen diesem Ziel zuwider. Diese betreffen alle Leistungserbringer, die ambulant erbrachte Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen möchten: nebst Ärztinnen und Ärzten auch die gestützt auf eine ärztliche Anordnung tätigen Gesundheitsfachpersonen wie beispielsweise Pflegefachpersonen. Aber auch psychologische Psychotherapeutinnen und –therapeuten sind davon betroffen, soweit sie ihre Leistungen zulasten der Krankenkasse abrechnen wollen.
Das neue Zulassungsrecht schränkt den Zugang von qualifizierten Fachpersonen aus dem benachbarten EU-Ausland ein und gefährdet die inländische Versorgung. Eine Folge davon ist, dass die Wartezeiten weiter zunehmen, obwohl der Bundesrat mit dem Wechsel vom Delegations- zum Anordnungsmodell genau die gegenteilige Zielsetzung verfolgt. Dieser Widerspruch ist umso unverständlicher, als das neue Zulassungsrecht zeitgleich mit dem Wechsel vom Delegations- zum Anordnungsmodell in Kraft getreten ist. Dieser Wertungswiderspruch wäre also zu vermeiden gewesen.
Neues Recht – neue Anforderungen
Das neue Zulassungsrecht stellt höhere Anforderungen an Personen, die ambulant erbrachte Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) abrechnen wollen. Dadurch soll die Qualität der durch die Krankenkassen vergüteten Leistungen gewährleistet werden. Um sicherzustellen, dass die Leistungen qualitativ hochstehend sind, müssen ambulant tätige Leistungserbringer praktische Berufserfahrung nachweisen. Das neue Zulassungsrecht verlangt, dass diese in der Schweiz erworben wurden. So müssen Ärztinnen und Ärzte während mindestens drei Jahren im beantragten Fachgebiet an einer anerkannten Weiterbildungsstätte in der Schweiz gearbeitet haben. Das Erfordernis, vorgängig in der Schweiz Berufserfahrung erworben zu haben, ist nicht auf Ärztinnen und Ärzte beschränkt. Es gilt für alle ambulant tätigen Leistungserbringer. So müssen die im ärztlichen Auftrag tätigen und für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens besonders wichtigen Pflegefachpersonen nach ihrem Diplom mindestens zwei Jahre unter der Leitung einer zugelassenen Pflegefachperson in der Schweiz tätig gewesen sein. Entsprechendes gilt auch für psychologische Psychotherapeutinnen und –therapeuten. Um zur Tätigkeit zulasten der OKP zugelassen zu werden, ist ein weiteres Jahr klinische Erfahrung notwendig – zusätzlich zu der für den eidgenössischen Weiterbildungstitel vorausgesetzten zweijährigen praktischen Tätigkeit. Davon müssen mindestens 12 Monate in einer anerkannten psychotherapeutisch-psychiatrischen Weiterbildungsstätte in der Schweiz absolviert worden sein.
Diese Anforderungen stehen in Widerspruch zum Mangel an qualifizierten Psychiatern und psychologischen Psychotherapeuten und den dadurch verursachten Wartezeiten. Das Erfordernis der in der Schweiz erworbenen Berufserfahrung betrifft vor allem ausländische Psychotherapeutinnen und -therapeuten, die sich dafür interessieren, in der Schweiz berufstätig zu werden. Rechtspolitisch macht es aber wenig Sinn, den Zuzug von qualifizierten Psychotherapeutinnen und -therapeuten aus dem benachbarten Ausland zu erschweren, wenn im Inland eine Unterversorgung besteht. Man kann das Abwerben von ausländischen Psychotherapeutinnen und -therapeuten als unethisch kritisieren. Bei der gegenwärtigen Unterversorgung bringt diese Kritik jedoch keine Lösung. Vielmehr ist die Schweiz auf ausländische Psychotherapeutinnen und -therapeuten angewiesen, um noch längere Wartezeiten und damit verbundene Folgekosten zu vermeiden.
Doch das neue Zulassungsrecht sieht noch weitere Einschränkungen vor. So sind Psychotherapeutinnen und -therapeuten verpflichtet, bei jedem Kantonswechsel eine neue Zulassung einzuholen. Nach Auffassung des BAG soll dafür das vereinfachte Verfahren nach dem Binnenmarktgesetz nicht zur Verfügung stehen. Dies hat zur Folge, dass ein Bewerber für eine Stelle in einem anderen Kanton die Zulassungsvoraussetzungen in einem aufwändigen Verfahren von neuem prüfen lassen muss. Dadurch wird nicht nur der Zuzug ausländischer Psychotherapeutinnen und -therapeuten, sondern auch die Mobilität innerhalb der Schweiz erschwert.
Die neuen Anforderungen wollen gewährleisten, dass Psychotherapeutinnen und -therapeuten mit einer möglichst grossen Zahl von Fällen und Krankheitsbildern konfrontiert wurden und über gute Kenntnisse des schweizerischen Gesundheitssystems verfügen, bevor sie ihre Tätigkeit zulasten der Krankenkasse aufnehmen. Anders als bei Ärztinnen und Ärzten ist es jedoch fraglich, inwiefern die Kenntnis des Schweizer Gesundheitssystems für die gestützt auf eine ärztliche Anordnung tätigen Psychotherapeutinnen und -therapeuten wirklich notwendig ist.
Verstoss gegen das Freizügigkeitsabkommen
Von mangelndem Verständnis für die realen Bedürfnisse des Schweizer Gesundheitswesens zeugt nicht nur die politische Stossrichtung. Vielmehr verstossen die Anforderungen des neuen Zulassungsrechts auch gegen das EU Freizügigkeitsabkommen, das Aufnahme der beruflichen Tätigkeit von EU-Bürgern in der Schweiz gewährleistet.
In ungewohnt deutlichen Worten hat der Bundesrat seine Bedenken gegen die Vereinbarkeit des neuen Zulassungsrechts mit dem Freizügigkeitsabkommen geäussert und das Parlament aufgefordert, "über eine Anpassung der entsprechenden Bestimmung nachzudenken". Zwar lässt er offen, wie die Gerichte über die neuen Zulassungsbestimmungen entscheiden könnten. Zumindest aus europapolitischen Gründen ist er aber der Meinung, dass das neue Zulassungsrecht geändert werden muss:
"Eine wie von der EU geforderte FZA-konforme Regelung in Artikel 37 KVG würde bedingen, dass dessen Regelungsinhalt ganz grundsätzlich überdacht wird."
Besorgt über die Rechtmässigkeit des Zulassungsrechts äusserten sich auch verschiedene Parlamentarier, vgl. Votum Frau Nationalrätin Manuela Weichelt:
"Die Vorlage ist eine reine Symptombekämpfung und zeigt, dass wir als Parlament unsorgfältig gearbeitet haben und nun schon wieder nachbessern müssen. […]. Die Bestimmungen im heutigen Recht stehen nicht im Einklang mit dem Freizügigkeitsabkommen. Die Bestimmungen verstossen gegen das Nichtdiskriminierungsverbot."
Im Vordergrund der parlamentarischen Beratung standen Ärztinnen und Ärzte, die zulasten der OKP tätig sein wollten. Die gleichen Überlegungen treffen aber auch auf Psychotherapeutinnen und –therapeuten zu. Die Anforderungen an die vorgängig in der Schweiz zu erwerbende Berufserfahrung benachteiligt ausländische Psychotherapeutinnen und –therapeuten gleich wie ausländische Ärztinnen und Ärzte.
Kein Ausweg durch Übergangsrecht
Zwar sieht das Übergangsrecht vor, dass Psychotherapeutinnen und –therapeuten zur Tätigkeit zulasten der OKP zugelassen werden können, auch wenn sie nicht 12 Monate in einer anerkannten psychotherapeutisch-psychiatrischen Weiterbildungsstätte in der Schweiz tätig gewesen waren. Stattdessen soll es ausreichend sein, wenn sie am 1. Juli 2022 – also zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Anordnungsmodells über eine psychotherapeutische Berufserfahrung in der psychotherapeutisch-psychiatrischen Versorgung von mindestens drei Jahren verfügen, die von einer qualifizierten Supervision begleitet wurde.
Weder die Verordnung des Bundesrates noch die Erläuterungen des BAG oder die kantonalen Merkblätter äussern sich dazu, ob die Tätigkeit ausschliesslich oder zumindest teilweise und falls ja, in welche Umfang in der Schweiz ausgeübt werden muss. Die Antwort auf diese Frage kann aber letztlich dahingestellt bleiben. Denn verstossen die Anforderungen an die vor der Zulassung in der Schweiz zu erwerbenden Berufserfahrung gegen das EU-Freizügigkeitsabkommen, so muss entsprechendes auch für die Übergangsbestimmungen gelten. Diese dürfen die Berufsaufnahme durch EU-Psychotherapeutinnen und –therapeuten in der Schweiz nicht dahingehend erschweren, dass sie die Zulassung zur Tätigkeit zulasten der OKP von einer vorgängig in der Schweiz zu erwerbenden Berufsausübung abhängig machen.
Alternative Lösungsansätze
Das neue Zulassungsrecht erweckt den Eindruck eines wenig durchdachten Flickwerkes. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass das Parlament dieses bereits nach wenigen Monaten wieder geändert und für Ärztinnen und Ärzte eine Ausnahme erlassen hat. Die vom Gesetzgeber erlassene Ausnahme ist umso unverständlicher, als sich das Parlament bewusst war, dass das Zulassungsrecht gegen das EU-Freizügigkeitsabkommen verstösst und damit insgesamt zu überdenken war.
Das parlamentarische Versäumnis betrifft alle ambulant tätigen Leistungserbringer. In ihrer Interpellation hat Frau Nationalrätin Bulliard-Marbach die Unterversorgung in der Psychiatrie und Psychotherapie sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie zwar thematisiert (Interpellation 23.3304 vom 16. März 2023), doch ist das Parlament von einer Lösung noch weit entfernt. Dies obwohl die Massnahmen auf der Hand liegen: Zur Aufrechterhaltung der Versorgung ist das Schweizer Gesundheitswesen auf den Zuzug qualifizierter Leistungserbringer aus dem Ausland dringend angewiesen. Eine nachhaltige und zukunftstaugliche Lösung darf die Augen vor der Auslandabhängigkeit nicht verschliessen. Die Stärkung der inländischen Aus- und Weiterbildung ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht ausreichend. Um der Unterversorgung entgegenzuwirken, müssen die Rahmenbedingungen im Spital und im ambulanten Bereich verbessert werden. Eine allein auf den Zugang zur OKP beschränkte Regulierung ist nicht in der Lage, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Vielmehr ist auf ein attraktives Berufsumfeld zu achten. Dabei sind ausländische Fachkräfte zu integrieren und auf die schweizerischen Bedürfnisse anpassen.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu dieser Veröffentlichung haben oder weitere Informationen über unsere Expertise im Bereich Life Science and Healthcare benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.