
Am 29. Juni, bei der letzten Gelegenheit vor der Sommerpause, fand die seit März 2017 im Plenum des Nationalrats zur Verhandlung anstehende kleine Ökostrom-Novelle endlich die verfassungsrechtlich erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Sie soll mehr Förderungen und weniger Belastungen für alle bringen. Wir zeigen, was wirklich kommt.
1. Änderungen in der Tarifförderung verringern den Zeitdruck für Antragsteller
Neu ist eine Verlängerung der Verfallsfrist von Anträgen für Wind-, Wasserkraft- und rohstoffabhängige Anlagen von drei auf fünf Jahre, d.h. der Antrag erlischt jedenfalls nach Ablauf des fünften Folgejahres nach Einlangen (§ 15 Abs 5 ÖSG).
Erbringt jedoch ein Antragsteller für eine Photovoltaikanlage nicht binnen drei Monaten nach Annahme des Antrages einen Nachweis über die Bestellung der Photovoltaikanlage, gilt der Vertrag über die geförderten Tarife als aufgelöst (§ 15 Abs 6 ÖSG). Aber Achtung: die gesamte Anlage muss bestellt worden sein, nicht bloß wichtige Komponenten wie die PV-Module. Unter der Anlage ist somit die Gesamtheit aller Einrichtungen zu verstehen, die dem Zweck der Ökostromerzeugung dienen und in einem technisch-funktionalen Zusammenhang stehen (§ 5 Abs 1 Z 5 und Z 23 ÖSG).
Die Inbetriebnahme-Fristen sind seit 27.07.2017 für PV-Anlagen verkürzt, jene für Windkraftanlagen verlängert (jeweils ab Vertragsausstellung):
Art der Anlage | Neu | Alt |
PV | 9 Monate | 12 Monate |
Wind | 48 Monate | 36 Monate |
Kleinwasserkraft, Rohstoffabhängige Anlage | 36 Monate | 36 Monate |
Sonstige | 24 Monate | 24 Monate |
Ein Ausweg in diesen Fällen sieht so aus: Der Antragsteller muss glaubhaft machen, dass die Ursachen für die verspätete Bestellung/Inbetriebnahme nicht in seinem Einflussbereich liegen.
Antragstellung für Wartelistenabbau Wind bis 31.12.2017: Hier gilt nicht „first come, first served“. Die Antragstellung für den Wartelistenabbau erfolgt zwischen 01.10.2017 und 31.12.2017. Es besteht aber kein Zeitdruck für die Antragstellung auf sofortige Kontrahierung, weil die Reihung der ursprünglichen Antragstellung auf Fördertarif weiter gilt. Die vom Abbau der Warteliste betroffenen Antragsteller werden von der OeMAG schriftlich per E-Mail kontaktiert.
Wartelistenabbau Wasser: Die Antragstellung für den Wartelistenabbau erfolgt ebenfalls zwischen 1.10.2017 und 31.12.2017. Auch für Wasserkraftanlagen besteht aufgrund der Möglichkeit zur Antragstellung innerhalb des gesamten dreimonatigen Zeitraumes kein Zeitdruck. Betroffene Antragsteller werden schriftlich per E-Mail kontaktiert.
Für PV-Anlagen gibt es keinen Wartelistenabbau (§ 15 Abs 7 ÖSG). Anträge sind zurückzuweisen, sofern zum Zeitpunkt ihres Einlangens das Unterstützungsvolumen bereits ausgeschöpft war.
2. Änderungen bei der Investitionsförderung
Die Investitionszuschüsse in § 26 und § 27 ÖSG mussten an die neue allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (VO 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit der Artikel 107 und 108 AEUV) angepasst werden.
Verschärfte Rahmenbedingungen für PV-Anlagenbetreiber: PV-Anlagenbetreiber gehören zu den Verlierern der Novelle, da – wie oben ausgeführt – kurze Bestellfristen sowie kürzere Fertigstellungsfristen gelten und es keinen Wartelistenabbau gibt. Darüber hinaus wird die Investitionsförderung mit je 15 Millionen Euro für 2018 und 2019 begrenzt (§ 27a Abs 2 ÖSG). Erstmals wird auch die Errichtung von Stromspeichern bundesweit gefördert.
Politisch gewünscht und deshalb mehr gefördert sind PV-Anlagen auf Freiflächen mit einer Engpassleistung zwischen 20 kWp und 500 kWp (§ 20 Abs 3 ÖSG).
Dafür wird es die kritisierte Benachteiligung von PV-Anlagen durch Wertung der gelieferten Strommenge statt – wie bisher – der installierten Leistung nicht mehr geben.
Kleinwasserkraft ist einer der Gewinner: Die Novelle sieht eine Erhöhung des Unter-Kontingents für Investitionszuschüsse für Kleinwasserkraft von 16 Mio EUR auf EUR 20 Mio. jährlich schon ab 2017 (§ 26 Abs 2 ÖSG) vor. Weiters wurde eine Erhöhung der Fördersätze um +5% bzw. +250 EUR/kW durchgängig über alle Klassen ab 01.08.2017 beschlossen (§ 26 Abs 3 ÖSG):
Leistung | Neu | Alt |
0 – 500 kW | max. 35% / max. 1.750 €/kW | max. 30% / max. 1.500 €/kW |
500 – 2.000 kW | max. 25% / max. 1.250 €/kW | max. 20% / max. 1.000 €/kW |
2 MW – 10 MW | max. 15% / max. 650 €/kW | max. 10% / max. 400 €/kW |
Die Investitionsförderung für Kleinwasserkraft beträgt seit der Novelle 16 Mio EUR jährlich und einmalig für 2018 zusätzlich 20 Mio EUR.
Investitionsförderung Wind: Auch für Wind gibt es ein einmaliges zusätzliches Förder-Volumen von 30 Mio für 2017 und 15 Mio EUR für 2018 (§ 23a ÖSG).
3. Ökostromanlagenregister
Neu eingeführt wurde auch ein durch die OeMAG (Abwicklungsstelle für Ökostrom AG) zu führendes Register, in welchem alle Anlagen mit Fördervertrag der OeMAG verzeichnet sind. Die OeMAG ist verpflichtet, aus diesem Register Daten zur Verfügung zu stellen und zwar den Netzbetreibern, der E-Control, den Landeshauptleuten sowie dem BMWFW.
4. Gemeinschaftliche Anlagen auf Mehrfamilienhäusern (ElWOG-Novelle)
Durch Einführung eines § 16a wurde die gemeinsame Nutzung von Erzeugungsanlagen, insbesondere PV-Anlagen (potenziell auch KWK und andere Technologien), auf Mehrfamilienhäusern und anderen Gebäuden ermöglicht.
5. Ja zu Biogas-Förderung, Nein zu Abwrackprämie für unprofitable Anlagen
Die umstrittene Abwrackprämie für unrentable Biogas-Anlagen wurde nicht umgesetzt. Zur Erinnerung: Weil die Biogas-Förderung nach 15 Jahren ausläuft und deshalb älteren, weniger wirtschaftlichen Betreibern nach Wegfallen der Subventionen die Pleite drohte, hatte das Regierungsprogramm 2013-2018 in Kapitel „Sichere Energieversorgung für Österreich" eine „Stranded-Cost"-Lösung zur Stilllegung alter Biogasanlagen und eine Verlängerung der Förderung für energieeffizientere Anlagen der 2. Generation vorgesehen. Da die Arbeiterkammer dies verhindert hatte, gilt stattdessen seit 1.8.2017 eine Biogas-Nachfolgetarifverordnung 2017. Sie sieht für Verträge zum Nachfolgetarif gem. § 17 ÖSG idgF ein Unterstützungsvolumen von 11,7 Mio. € jährlich bis zum 31.12.2021 vor.
Brennstoffnutzungsgrad | Cent/kWh |
> 60,0% bis 62,5% | 15,57 |
> 62,5% bis 65,0% | 16,57 |
> 65,0% bis 67,5% | 17,57 |
> 67,5% | 18,57 |
Der Nachfolgetarif ist mit der Höhe der bisherigen Vergütung begrenzt, es sei denn, die Anlage wurde im Hinblick auf die Erreichung eines erhöhten Brennstoffnutzungsgrades ertüchtigt.
Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Nachfolgetarifs ist vom Anlagenbetreiber ein Konzept vorzulegen, wie die Anlage nach dem 20. Betriebsjahr Ökostrom ohne Inanspruchnahme von Förderungen erzeugen kann. Die Ökostromabwicklungsstelle hat die Angaben zu prüfen. Die Gewährung eines Nachfolgetarifs ist zu versagen, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird.
Anträge auf Nachfolgetarif können ausschließlich von 1. Oktober bis 31. Dezember 2017 für Biogasanlagen gestellt werden, wobei der Antrag frühestens 60 Monate vor Ablauf der Förderlaufzeit eingebracht werden kann. Die Reihung der Anträge erfolgt primär nach qualitativen Kriterien gem. § 17 Abs 6 und Abs. 7 ÖSG, der Zeitpunkt der Antragstellung spielt somit eine untergeordnete Rolle.
Die Erreichung des Brennstoffnutzungsgrades muss bei Antragstellung durch ein Gutachten nachgewiesen werden. Außerdem ist die Erreichung des Brennstoffnutzungsgrades für jedes abgeschlossene Kalenderjahr bis spätestens 31. März des Folgejahres der Ökostromabwicklungsstelle nachzuweisen. Dies muss insbesondere durch den Einbau eines dem Stand der Technik entsprechenden Wärmemengenzählers sowie durch messtechnische Erfassung der genutzten Wärmemenge geschehen.
6. Entbürokratisierung für Anerkennungsbescheide:
Ab 1.1.2018 werden für Photovoltaik-, Windkraft- und Kleinwasserkraftanlagen für die Antragstellung keine Anerkennungsbescheide mehr benötigt (§ 7 ÖSG). Stattdessen wird die OeMAG die Voraussetzungen bei Abschluss des Fördervertrages (§ 15a und § 15b ÖSG) prüfen und geförderte Anlagen in ein neu zu etablierendes, von der OeMAG zu führendes Ökostromanlagenregister aufnehmen (§ 37 Abs 5 ÖSG). Nur noch für rohstoffabhängige Anlagen (Biomasse, Biogas) sind weiterhin Anerkennungsbescheide des Landeshauptmanns (als Ökostromanlage) vorzulegen.
7. Hintergrund-Info: Beihilfenrechtskonformes Fördersystem
Das ÖSG beruhte in seiner Förderstruktur auf den EU-Leitlinien für staatliche Umweltschutzbeihilfen vom 1.4.2008. Am 1.7.2014 traten neue Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen in Kraft. Bestehende, genehmigte Beihilferegelungen für Betriebsbeihilfen für Erneuerbare Energien (und Kraft-Wärme-Kopplung) wie im ÖSG müssen angepasst werden, wenn sie verlängert werden sollen.Mit der Novelle 2017 werden nur Änderungen im Rahmen des beihilferechtlich genehmigten Fördersystems umgesetzt. Eine künftige Neugestaltung des Fördersystems in einer großen Novelle (z.B. ein Abgehen von geförderten Einspeisetarifen und/oder Betriebsförderungen) wird auf Basis der neuen Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen umzusetzen sein.
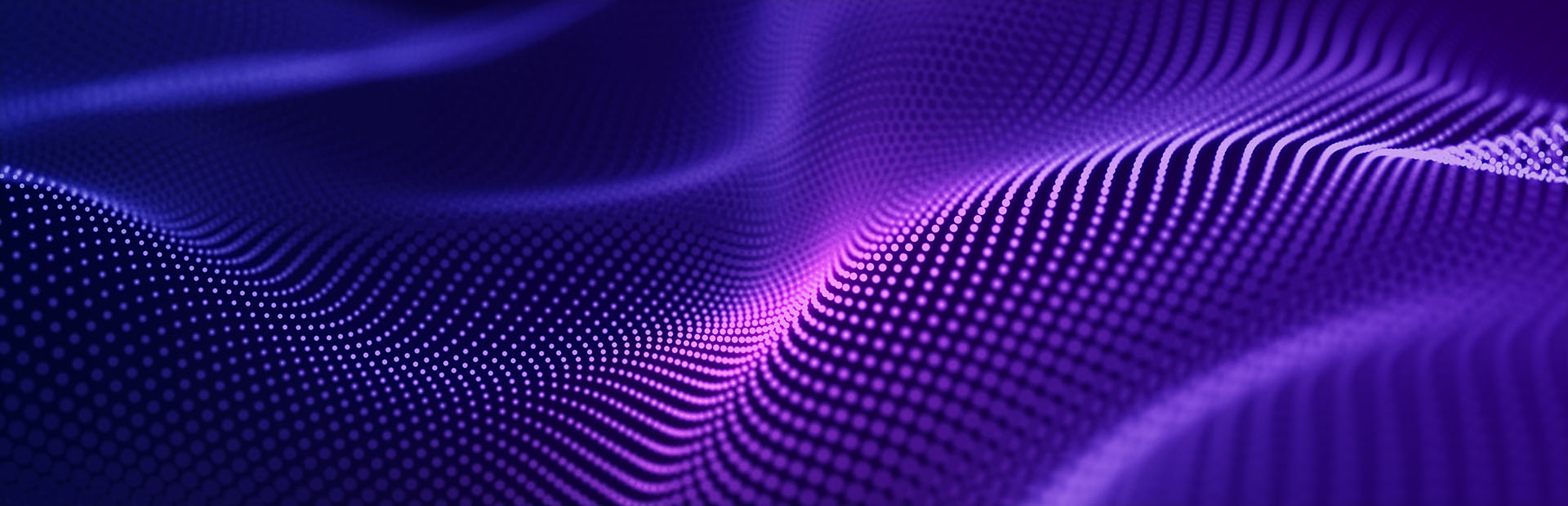



.jpg)
