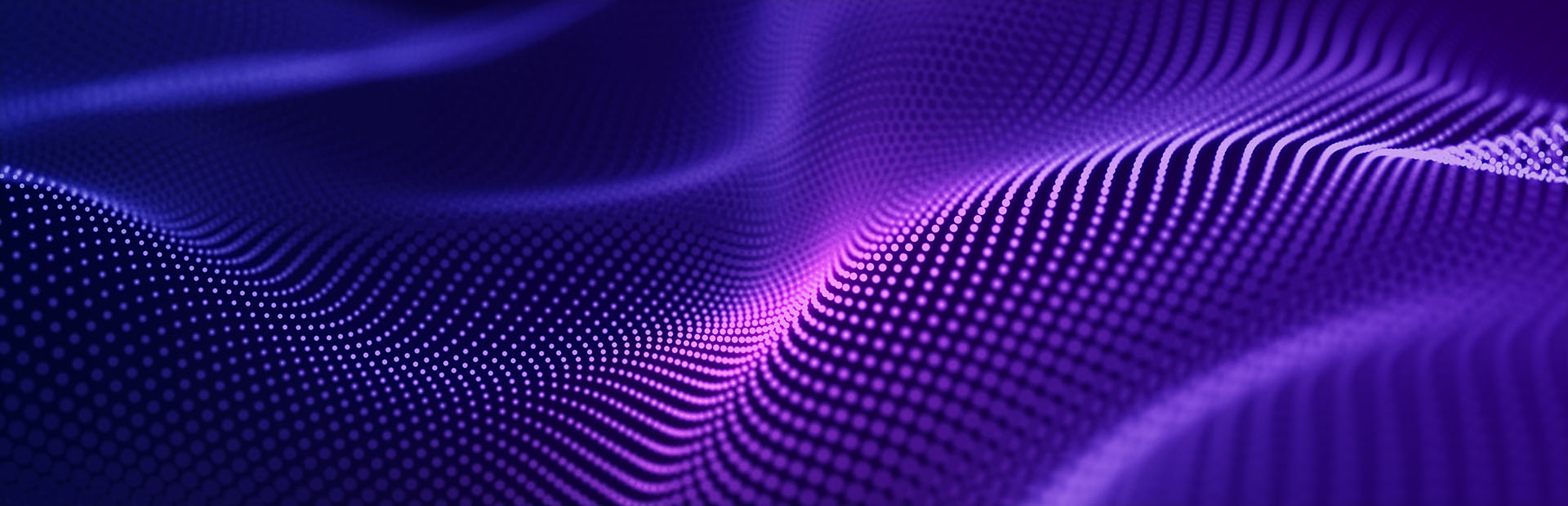Solaranlagen in der Schweiz - ein Überblick aus rechtlicher Sicht

Autoren
Das Netto-Null-Ziel für das Jahr 2050 wird als Teil des Schweizer Klima- und Innovationsgesetzes (KIG) per 1. Januar 2025 in Kraft treten. Für die Erreichung dieses Ziels und für den Klimaschutz insgesamt kommt dem Gebäudesektor eine Schlüsselrolle zu: Aktuell verbraucht der Gebäudepark Schweiz ca. 40% des gesamten Energiebedarfs der Schweiz.
In Zukunft wird der Stromverbrauch zudem in den meisten Haushalten und Unternehmen durch den vermehrten Einsatz von Wärmepumpen sowie aufgrund der stetig wachsenden Elektromobilität deutlich ansteigen. Photovoltaikanlagen und Solaranlagen im Allgemeinen sind ein vielversprechender Ansatz zur Lösung dieses Problems: So geht das Bundesamt für Energie davon aus, dass bis 2050 mehr als 40 % des künftigen Strombedarfs durch Photovoltaik gedeckt werden sollen.
Pflicht zur Installation von Solaranlagen
Auf Bundesebene wurde im Herbst 2022 der sog. Solarexpress (dringliche Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter) erlassen, der Verpflichtungen zur Installation von Solaranlagen (Photovoltaik oder Solarthermie) auf Dächern oder an Fassaden von Neubauten beinhaltet. Diese Massnahmen gelten noch bis zum 31. Dezember 2025, sollen jedoch mit dem geplanten neuen Stromgesetz (Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung aus erneuerbaren Energien) dauerhaft in Kraft gesetzt werden: Wird das Gesetz anlässlich der Volksabstimmung im Juni 2024 angenommen, tritt es per 1. Januar 2025 in Kraft.
Auch wenn es auf Bundesebene nur Verpflichtungen zur Installation von Solaranlagen auf Neubauten gibt, besteht in der Praxis auch ein grosses Interesse an der Installation von Solaranlagen (insbesondere Photovoltaikanlagen) auf bestehenden Gebäuden.
Weiter gibt es auf kantonaler Ebene bereits verschiedene gesetzliche Verpflichtungen zur Installation von Solaranlagen, und es werden laufend weitere Massnahmen in diesem Bereich diskutiert.
Anreize für die Installation von Solaranlagen
Vereinfachung des Baubewilligungsverfahrens
Das Raumplanungsgesetz (RPG) sieht vor, dass in Bau- und Landwirtschaftszonen für "genügend angepasste" Solaranlagen auf Dächern keine Baubewilligung erforderlich ist. Diese Anlagen müssen den zuständigen Behörden lediglich gemeldet werden. Die Kantone und Gemeinden können dieses Meldeverfahren zudem auch auf andere Solaranlagen (z.B. Fassadenanlagen) ausdehnen.
Weitere Anreize
Nach dem Energiegesetz (EnG) muss überschüssiger Solarstrom vom lokalen Netzbetreiber (Elektrizitätswerk) abgenommen und "angemessen" vergütet werden. Abgesehen von bestimmten gesetzlichen Vorgaben kann dabei jedes Elektrizitätswerk die Vergütung selbst festlegen. Dadurch variieren die Vergütungstarife derzeit stark. Mit dem Stromgesetz (vgl. vorstehend) soll hier jedoch eine gewisse Harmonisierung erreicht werden, d.h. der Strompreis soll sich nach dem Marktpreis richten mit einer definierten Mindestvergütung.
Ein weiterer Anreiz für die Installation von Solaranlagen sind Förderbeiträge. Photovoltaikanlagen werden bundesweit mittels Einmalvergütungen (EIV) gefördert, wobei die Höhe der Vergütung und das anwendbare Verfahren je nach in Frage stehender Photovoltaikanlage unterschiedlich sind. Darüber hinaus bestehen weitere Förderprogramme einzelner Kantone, Gemeinden und Energieversorger.
Schliesslich gibt es auch steuerliche Anreize für die Erstellung von Photovoltaikanlagen. So stellt etwa das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer die Investitionen in Liegenschaften des Privatvermögens, die dem Energiesparen und Umweltschutz dienen, den abzugsfähigen Unterhaltskosten gleich. Die Erstellungskosten für Photovoltaikanlagen sind auf Bundesebene deshalb steuerlich abziehbar, was eine Ausnahme vom Grundsatz darstellt, dass wertvermehrende Investitionen im Privatvermögen steuerlich nicht abzugsfähig sind. Als weitere Besonderheit sieht der Bundesgesetzgeber vor, dass Auslagen, die in der ersten Steuerperiode nicht vollständig abgezogen werden konnten, auch noch in den zwei nachfolgenden Steuerperioden abzugsfähig sind. Obwohl die Kantone ihrerseits nicht verpflichtet sind, energetische Massnahmen steuerlich zu fördern, sehen die meisten von ihnen solche Fördermassnahmen vor.
Möglichkeiten und rechtliche Struktur bei der Installation von Photovoltaikanlagen
Der Eigenverbrauch von Strom (d.h. der Verbrauch am Ort der Produktion) lohnt sich im Grundsatz, da der Strompreis neben dem Preis für die Elektrizität auch Netznutzungskosten sowie Abgaben enthält. Diese fallen beim Eigenverbrauch weg.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Bau und Betrieb einer Photovoltaikanlage betrieblich und rechtlich umzusetzen. Dazu gehören:
Installation und Betrieb einer Photovoltaikanlage durch die Gebäudeeigentümer:in
Die Gebäudeeigentümer:in verkauft den selbst produzierten Strom an die Mieterschaft und gründet zu diesem Zweck einen sog. Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV). Davon profitieren grundsätzlich alle Beteiligten (auch finanziell). In Bezug auf den Verkauf von Strom an Mieter:innen müssen jedoch verschiedene mietrechtliche Vorgaben beachtet werden: Insbesondere gibt es gesetzliche Vorgaben für die Berechnung des Strompreises.
Auch das öffentliche Recht spielt bei vertraglichen Vereinbarungen betreffend Photovoltaikanlagen eine Rolle. Da der Strommarkt in der Schweiz teilweise liberalisiert ist, können beispielsweise sog. Grossverbraucher (Unternehmen mit einem Verbrauch von mehr als 100'000 kWh pro Jahr) ihren Stromlieferanten frei wählen und daher jederzeit aus einem solchen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch austreten.
Alternativ zum Zusammenschluss zum Eigenverbrauch kann der eigenproduzierte Solarstrom dem lokalen Elektrizitätswerk verkauft werden, welches ihn wiederum an die Mieter:innen weiterverkauft (dies hängt jedoch vom in Frage stehenden Elektrizitätswerk ab).
Installation und Betrieb einer Photovoltaikanlage durch eine dritte Partei
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Gebäudeeigentümer:in die Dach- oder Fassadenfläche des Gebäudes einer Drittperson zur Verfügung stellt. Dies kann in Form eines Mietvertrags oder – häufiger – eines Contracting-Vertrags erfolgen. Die Contracting-Firma (meist ein Energiedienstleistungsunternehmen) plant, finanziert, baut, betreibt und wartet die Photovoltaikanlage und liefert i.d.R. auch den Strom an die Gebäudeeigentümer:in. Einige Contracting-Firmen bieten zudem auch Dienstleistungen im Rahmen der ZEV-Verwaltung an.
In der Regel wird die Contracting-Firma eine Dienstbarkeit für die Nutzung des Daches, der Fassade und/oder der Photovoltaikanlage einrichten wollen, um sich dinglich abzusichern. Dabei stellen sich verschiedene rechtliche Fragen betreffend die grundbuchliche Ausgestaltung solcher Dienstbarkeiten, der Eigentumsverhältnisse an der Photovoltaikanlage sowie betreffend die Möglichkeit, die Photovoltaikanlage separat zu verpfänden (z.B. an eine Bank). In Ermangelung einer klaren gesetzlichen Regelung auf Bundesebene bzw. einer einschlägigen bundesgerichtlicher Rechtsprechung dazu haben verschiedene Kantone ihre eigenen Ansätze entwickelt. Jedenfalls empfiehlt es sich, dass die Parteien ein gemeinsames Verständnis der gegenseitigen Rechte und Pflichten inkl. der Eigentumsverhältnisse haben, das im Vertrag auch klar zum Ausdruck kommt.
Installation einer Photovoltaikanlage durch die Gebäudeeigentümer:in, Betrieb durch eine dritte Partei
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Gebäudeeigentümer:in die Photovoltaikanlage selbst errichtet und sie dann einer Drittpartei (durch Abschluss eines Pachtvertrags oder eines Betreibervertrages) zur Verfügung stellt. In diesem Szenario bleibt die Photovoltaikanlage rechtlich gesehen im Eigentum der Gebäudeeigentümer:in.
Ausblick
Das Inkrafttreten des Stromgesetzes wird dem Ausbau von Solaranlagen weiteren Auftrieb geben. Unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung im Juni 2024 bestehen bereits heute Förderprogramme für Solarenergie. Da die Stromnachfrage stetig steigen wird, wird auch die Installation von Solaranlagen in Zukunft weiter zunehmen. Bei der Wahl und Ausgestaltung des Betreibermodells einer Solaranlage ist eine klare vertragliche Definition der Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien essentiell.
Newsletter
Bleiben Sie stets informiert und abonnieren Sie unseren Newsletter.