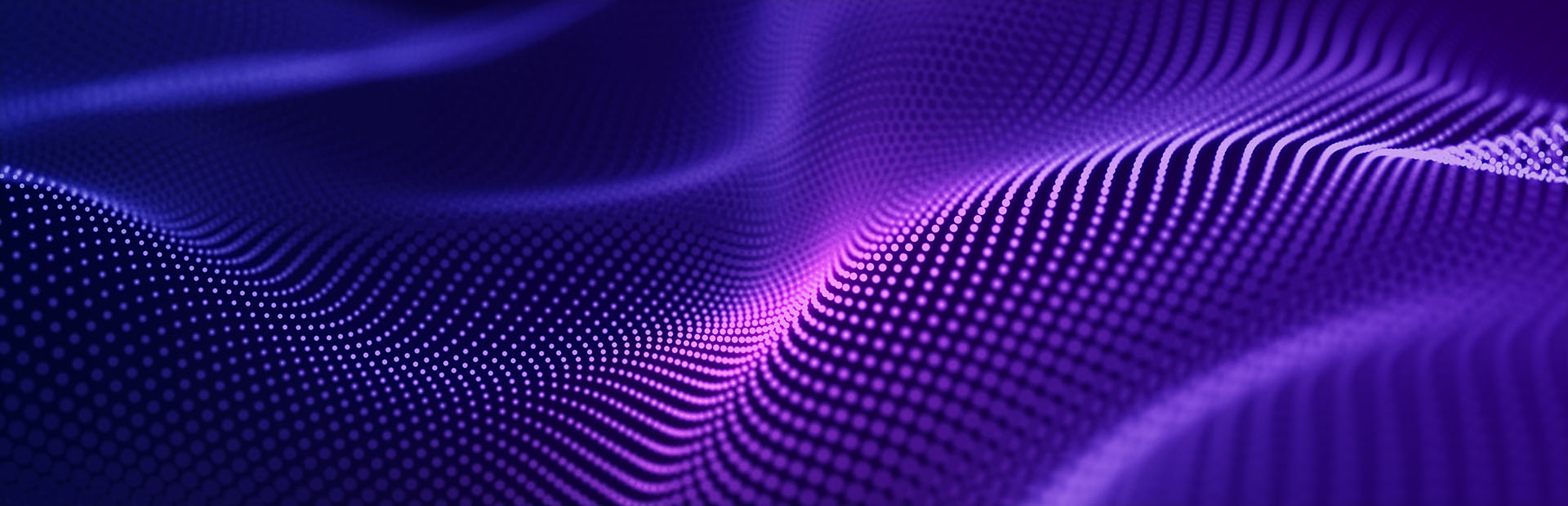Autoren
Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer stärker in den Fokus der Konsumentinnen und Konsumenten. So gibt es Untersuchungen, dass sich Produkte mit Green Claims besser verkaufen als andere. Doch wo liegen die Grenzen des Erlaubten bei Green Claims?
Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer stärker in den Fokus der Konsumentinnen und Konsumenten. So gibt es Untersuchungen, dass sich Produkte mit Green Claims besser verkaufen als andere. Doch wo liegen die Grenzen des Erlaubten bei Green Claims?
In der Schweiz gibt es bisher keine spezifischen Rechtsnormen, welche die Zulässigkeit von Green Claims explizit regeln. Stattdessen wird bei der Beurteilung der Rechtmässigkeit eines Claims das allgemeine Lauterkeitsrecht herangezogen. Dieses verlangt, dass alle Kommunikationsformen der Unternehmen, also auch Green Claims, wahr sein müssen. Die gemachten Aussagen müssen also richtig sein und dürfen nicht täuschen. Im Zweifel ist die Zulässigkeit eines Green Claims eine Ermessensfrage. Bisher gibt es in der Schweiz nur wenig Rechtsprechung, die klare Richtlinien vorgibt, wann ein Green Claim zulässig ist und wann nicht. Der Bereich ist jedoch in Bewegung und es ist zu erwarten, dass sich dies mittelfristig ändern wird.
Im Kontext von Social Media ist besonders wichtig, nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen des eigenen Landes, sondern auch die von anderen Jurisdiktionen zu befolgen. Denn die Inhalte auf den Plattformen sind weltweit verfügbar und erreichen Nutzerinnen und Nutzer aus verschiedenen Rechtsgebieten. So sind beispielsweise im europäischen Rechtsraum – im Unterschied zur Schweiz – bereits verschiedene spezifische Vorschriften für Green Claims in Kraft.
Eine Schwierigkeit besteht auch darin, dass nahezu jede Plattform das Thema „Green Claim“ anders behandelt. Die Plattformen haben aber oftmals keine spezifischen Vorgaben zur Benutzung von Green Claims. Dennoch erreichen sie Milliarden von Menschen überall auf der Welt.
Hinzu kommt, dass auf Social Media im Vergleich zu z.B. Marken- oder Urheberrechtsverletzungen, die fehlende Grundlage eines Green Claims weniger offensichtlich und eindeutig ist. Dies macht es für Drittunternehmen, Konsumentinnen und Konsumenten und auch für die Plattformen selbst schwieriger zu bestimmen, wann eine Aussage irreführend oder falsch und damit unzulässig ist.
Drei Wege zur Überprüfung
Was kann man tun, wenn man auf einen Green Claim stösst, der täuscht bzw. nicht wahr ist? In der Schweiz gibt es drei verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Die kostengünstigste Möglichkeit ist die Meldung des Claims mittels einer Beschwerde bei der Lauterkeitskommission. Die schweizerische Lauterkeitskommission ist ein Institut der Werbewirtschaft, sie ist also nicht öffentlich-rechtlich, sondern agiert auf privatrechtlicher Basis. Die Anzahl an Beschwerden vor der Lauterkeitskommission im Zusammenhang mit Green Claims ist gestiegen. Sie beurteilt die Claims relativ schnell und bietet damit eine effiziente Lösung. Allerdings kann die Lauterkeitskommission nur Empfehlungen abgeben, welche keinen rechtsverbindlichen Charakter haben und damit rechtlich nicht erzwungen werden können.
Eine zweite, jedoch deutlich kostenintensivere Möglichkeit, ist die Einleitung eines Verfahrens bei einem Zivilgericht durch die Einreichung eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen oder direkt durch Klageerhebung. Im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme bzw. in einem ordentlichen Verfahren wird versucht, einen irreführenden Green Claim zu entfernen. Neben der Unterlassung oder Beseitigung des Claims kann auch Schadenersatz geltend gemacht werden. Allerdings dürfte es schwierig sein, diesen Schaden zu beweisen. Als betroffener Konkurrent wäre zum Beispiel nachzuweisen, dass man sein eigenes Produkt besser verkauft hätte, wenn der Anbieter den Green Claim nicht verwendet hätte.
Die dritte Möglichkeit, gegen irreführende Green Claims vorzugehen, wäre die Einleitung eines Strafverfahrens durch einen Strafantrag. Dies kann allerdings sehr aufwendig sein, da die Antragstellerin über die blosse Einreichung einer Anzeige hinaus unter Umständen an mehreren Phasen des Verfahrens teilnehmen muss. Zudem ist nicht garantiert, dass solch ein Verfahren von den Strafverfolgungsbehörden tatsächlich an Hand genommen wird.
Daher erscheint die Einreichung einer Zivilklage die effektivste Option, wenn es um die tatsächliche Durchsetzung und Vollstreckung von Ansprüchen geht.
Generell gilt, dass Green Claims zunehmend an Bedeutung gewinnen und es zu erwarten ist, dass sie in Zukunft auch in der Schweiz stärker reguliert werden.