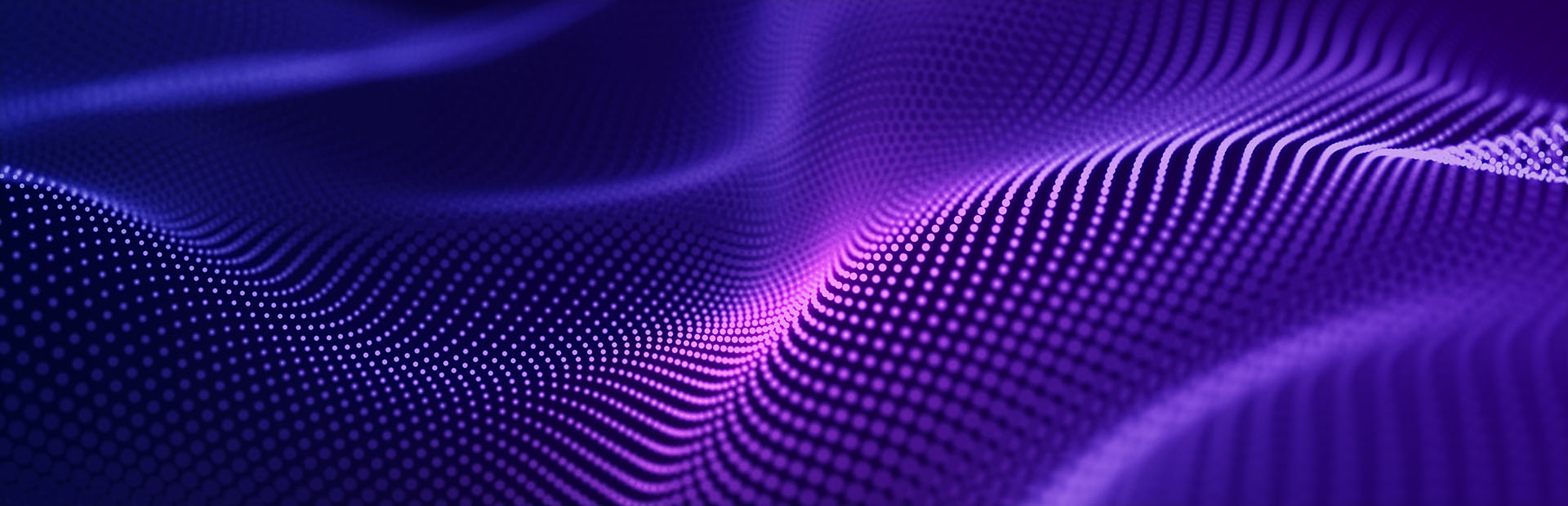Autoren
Inhalt
Im Folgenden finden Sie die Themen des Newsletters.
Aktuelle Rechtsprechung
- Zahlung per SEPA-Lastschrift darf nicht von Inlandswohnsitz abhängig gemacht werden
- Kfz-Hersteller müssen Ersatzteilinformationen (noch) nicht in verarbeitbarer Form zur Verfügung stellen
- Mängelrüge „nur an Betriebsleitung“ in AGB unwirksam
- BGH konkretisiert Informationspflichten zur Verbraucherstreitbeilegung
- Auskunftsanspruch über Unternehmervorteile zur Berechnung des Ausgleichsanspruchs von Handelsvertretern und Vertragshändlern
- Fehlende Kennzeichnung von Elektrogeräten mit „durchgestrichener Tonne“ kann abgemahnt werden
- Transportrechtlicher CMR-Gerichtsstand gilt auch für Direktansprüche gegen Haftpflichtversicherer
- Bundeskartellamt nennt Kriterien zur kartellrechtlichen Beurteilung von Bieter- und Liefergemeinschaften
Gesetzgebung und Trends
- Neue Regelungen für mehr Sicherheit bei Onlinezahlungen
- Ab 2020 verbesserte gegenseitige Anerkennung von Waren in der EU
Bei Interesse können Sie das Update Commercial hier abonnieren.
Aktuelle Rechtsprechung
Zahlung per SEPA-Lastschrift darf nicht von Inlandswohnsitz abhängig gemacht werden
(EuGH, Urteil v. 5. September 2019 – C-28/18)
- Eine Vertragsklausel, die eine Zahlung im SEPA-Lastschriftverfahren ausschließt, wenn der Zahler seinen Wohnsitz nicht in dem Mitgliedstaat hat, in dem der Zahlungsempfänger seinen Sitz hat, verstößt nach einem Urteil des EuGH gegen die sog. SEPA-Verordnung (VO [EU] Nr. 260/2012) und ist daher unzulässig.
- Ziel der Verordnung sei es unter anderem, Verbrauchern zu ermöglichen, für Lastschriftzahlungen innerhalb der Union nur ein einziges Konto zu nutzen. Lastschriftempfänger dürften daher keine Vorgaben dazu machen, in welchem Mitgliedstaat das Zahlungskonto zu führen sei. Da Verbraucher aber ihre Zahlungskonten in der Regel in ihrem Wohnsitzstaat unterhielten, verstoße das Erfordernis eines Wohnsitzes im Inland indirekt ebenfalls gegen dieses Verbot.
- Dabei sei irrelevant, ob den Verbrauchern alternative Zahlungsmethoden, wie etwa Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung, angeboten würden. Sobald (auch) eine Zahlung im SEPA-Lastschriftverfahren angeboten werde, seien die Voraussetzungen der SEPA-Verordnung einzuhalten.
(Online-)Händler und Dienstleister, die ihren Kunden eine Zahlung per SEPA-Lastschrift anbieten, müssen diese Möglichkeit nach der Entscheidung des EuGH Kunden aus der gesamten EU einräumen – auch wenn dies zu deutlich höherem Aufwand für Bonitätsüberprüfungen oder einem erhöhten Ausfallrisiko für den Zahlungsempfänger führen kann. Dass Kunden nicht aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder anderer sog. „Geo-Faktoren“ unterschiedlich behandelt werden dürfen, ergibt sich seit Dezember 2018 in vielen Fällen bereits aus der seitdem geltenden Geoblocking-Verordnung (VO [EU] 2018/302, wir berichteten im Update Commercial 12/2018). Für SEPA-Lastschriften stellt die SEPA-Verordnung allerdings noch strengere Vorgaben auf, da sie auch für risikoreiche Vorgänge keine Ausnahmen von dem Diskriminierungsverbot für Auslandszahlungen vorsieht. Es empfiehlt sich daher eine sorgfältige Abwägung, ob das Lastschriftverfahren europaweit angeboten werden kann oder aber die Zahlung per Lastschrift insgesamt ausgeschlossen werden sollte.
Kfz-Hersteller müssen Ersatzteilinformationen (noch) nicht in verarbeitbarer Form zur Verfügung stellen
(EuGH, Urteil v. 19. September 2019 – C-527/18)
- Automobilhersteller sind nach der derzeit geltenden Rechtslage nicht verpflichtet, freien Händlern und Werkstätten Reparatur- und Wartungsinformationen zu ihren Fahrzeugen in elektronisch weiterverarbeitbarer Form zu gewähren. Dies hat der EuGH auf eine Vorlagefrage des BGH (wir berichteten im Update Commercial 10/2018) entschieden.
- Nach der sog. Fahrzeugemissionsverordnung (VO [EG] Nr. 715/2007) seien Fahrzeughersteller lediglich verpflichtet, unabhängigen Marktteilnehmern einen „uneingeschränkten, standardisierten und leichten“ Onlinezugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen ihrer Fahrzeuge zu gewähren. Hierzu reiche aber ein reiner Lesezugriff aus.
- Der klagende Händlerverband hatte die Bereitstellung von elektronisch weiterverarbeitbaren Daten gefordert, da diese es unabhängigen Betrieben beispielsweise ermöglichen würden, durch eine Verknüpfung der Fahrzeugidentifikationsnummern mit Daten von freien Ersatzteilherstellern auch alternative Teilelisten für günstigere Ersatzteile zu erhalten. Dies sei jedoch weder vom Wortlaut der derzeit geltenden Fahrzeugimmissionsverordnung vorgesehen noch erfordere deren Zielsetzung – die Ermöglichung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem Reparatur- und Wartungsmarkt – zwingend Berechtigungen für Ersatzteilhändler und Werkstätten, die über einen bloßen Lesezugriff hinausgehen, befand der EuGH.
Die Entscheidung schafft Klarheit in einem seit Jahren andauernden Rechtsstreit, sie wird jedoch aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten Gesetzesänderung nicht lange relevant bleiben: Zwar können Automobilhersteller vorerst die bisher verbreitete Praxis, unabhängigen Betrieben nur Lesezugriffe auf ihre Reparatur- und Wartungsinformationen zu gewähren, noch beibehalten. Ab dem 1. September 2020 verpflichtet die dann geltende Typengenehmigungsverfahrens-Verordnung (VO [EU] 2018/858) die Hersteller jedoch ausdrücklich, diese sowie weitere relevante Informationen in maschinenlesbarer und elektronisch verarbeitbarer Form zur Verfügung zu stellen.
Mängelrüge „nur an Betriebsleitung“ in AGB unwirksam
(BGH, Beschluss v. 8. Januar 2019 – VIII ZR 18/18)
- Der BGH hat sich in einem Zurückweisungsbeschluss dahingehend geäußert, dass eine in B2B-Verträgen verwendete AGB-Klausel, nach der Mängel der Kaufsache ausschließlich gegenüber der „Betriebsleitung“ zu rügen sind, unwirksam sein dürfte.
- Eine solche Klausel benachteilige den Vertragspartner unangemessen, weil sie das Risiko, ob eine an den Verwender gerichtete Mängelrüge unternehmensintern die „Betriebsleitung“ erreicht, dem Vertragspartner auferlege.
Der rechtzeitigen Mängelrüge kommt im unternehmerischen Geschäftsverkehr eine erhebliche Bedeutung zu. Die gesetzlichen Anforderungen an die Rechtzeitigkeit der Rüge sind dabei bereits sehr streng. Das Handelsgesetzbuch schreibt vor, dass Mängel „unverzüglich“ nach ihrer Entdeckung gerügt werden müssen, die Gerichte lassen hier meist nur Fristen von (höchstens) wenigen Tagen zu. Eine weitere vertragliche Verschärfung dahingehend, dass der Käufer auch noch dafür Sorge tragen muss, dass die Rüge innerhalb dieser kurzen Fristen auch bestimmte Adressaten beim Verkäufer erreicht, lehnte der BGH ab. Verkäufer, die in ihren AGB den rechtzeitigen Zugang von Mängelrügen an weitere formale Voraussetzungen knüpfen, sollten die entsprechenden Klauseln daher einer Überprüfung unterziehen.
Siehe hierzu auch unseren Blogbeitrag „BGH zur vertraglichen Gestaltung der Mängelrüge“ vom 22. Oktober 2019.
BGH konkretisiert Informationspflichten zur Verbraucherstreitbeilegung
(BGH, Urteil v. 21. August 2018 – VIII ZR 263/18 / BGH, Urteil v. 21. August 2019 – VIII ZR 265/18)
- Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) sieht vor, dass Unternehmer mit mehr als zehn Beschäftigten auf ihrer Homepage und / oder in ihren AGB darüber informieren müssen, inwieweit sie bereit oder verpflichtet sind, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, und – wenn sich der Unternehmer zur Teilnahme verpflichtet hat oder er gesetzlich zur Teilnahme verpflichtet ist – auch die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle anzugeben haben. Der BGH hat diese Informationspflichten nun in zwei aktuellen Entscheidungen konkretisiert.
- Zum einen stellte er klar, dass die betroffenen Unternehmer nicht schon immer dann die zuständige Schlichtungsstelle angeben müssen, wenn sie im Rahmen ihrer Informationspflicht die Bereitschaft zur Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren erklären. Eine konkrete Schlichtungsstelle müsse nur genannt werden, wenn entweder eine gesetzliche Teilnahmeverpflichtung bestehe oder der Unternehmer sich durch eine freiwillige Unterwerfung unter ein bestimmtes Regelwerk (wie beispielsweise Mediations- bzw. Schlichtungsabreden oder Vereinssatzungen) oder durch eine bindende rechtsgeschäftliche Erklärung gegenüber den Verbrauchern (z. B. eine Schlichtungsklausel in seinen AGB) verbindlich zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren verpflichtet habe. Der bloße Hinweis auf eine Teilnahmebereitschaft, wie das VSBG ihn vorsieht, begründe aber noch keine derartige Teilnahmeverpflichtung.
- Zum anderen entschied der BGH, dass eine Mitteilung des Unternehmers, dass die Bereitschaft zu einer Teilnahme an einem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren „im Einzelfall“ erklärt werden könne, nicht den Anforderungen des VSBG entspricht. Danach müssen die Informationen leicht zugänglich, klar und verständlich erteilt werden. Seien Unternehmer nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Teilnahme bereit, müssten Sie trennscharfe Kriterien nennen, inwieweit diese Bereitschaft bestehe (z. B. bestimmte Vertragstypen, Streitgegenstände oder Streitwerte).
Sofern Unternehmer nicht gesetzlich verpflichtet sind, an einem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teilzunehmen, sollen sie frei entscheiden können, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen sie zur Durchführung eines solchen Verfahrens bereit sind. Diese Freiwilligkeit stellt auch der BGH in seinen Entscheidungen noch einmal deutlich heraus. Unternehmer, die nur in bestimmten Fällen zur außergerichtlichen Streitbeilegung bereit sind, müssen die Voraussetzungen hierfür allerdings klar kommunizieren. Entsprechende Erklärungen sollten daher dahingehend überprüft werden, ob sie so eindeutig formuliert sind, dass die Verbraucher im Vorfeld erkennen können, ob im Falle einer Auseinandersetzung die Möglichkeit der Durchführung eines Schlichtungsverfahrens angeboten wird oder nicht.
Auskunftsanspruch über Unternehmervorteile zur Berechnung des Ausgleichsanspruchs von Handelsvertretern und Vertragshändlern
(OLG Frankfurt, Urteil v. 13.03.2019 – 12 U 37/18)
- Handelsvertreter und Vertragshändler, denen nach der Beendigung ihres Vertriebsvertrags ein Ausgleichsanspruch nach § 89 b HGB (analog) zusteht, können nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt zur Vorbereitung dieses Ausgleichsanspruchs auch dann Auskunft über die dem Unternehmer aus den Geschäftsverbindungen mit den vom Vertriebspartner geworbenen Kunden verlangen, wenn sie ihre Provisionsverluste aufgrund der Vertragsbeendigung konkret beziffern können.
- Nach der im Jahr 2009 erfolgten Änderung der HGB-Vorschrift sei für die Berechnung des Ausgleichsanspruchs nun gerade die Höhe der dem Unternehmer verbleibenden Vorteile maßgeblich. Diese seien grundsätzlich unabhängig von den dem Vertriebspartner entgehenden Provisionsansprüchen und müssten diesen nicht entsprechen. Da es dem Vertriebspartner in der Praxis allerdings kaum möglich sei darzulegen, dass die Unternehmervorteile die Provisionsverluste übersteigen (weil dies regelmäßig Informationen über die interne Kalkulation des Unternehmers erfordere), könne der Vertriebspartner grundsätzlich Auskunft über diese Vorteile verlangen, um seinen Ausgleichsanspruch zu beziffern.
- Das OLG Düsseldorf hatte 2017 noch geurteilt, dass der Ausgleichsanspruch auch nach der Gesetzesänderung weiterhin auf Grundlage der Provisionsverluste berechnet werden könne, wenn nicht im Einzelfall besondere Umstände dafür sprächen, dass die Unternehmervorteile die Provisionsverluste übersteigen. Es hatte einen Auskunftsanspruch daher nur für den Fall bejaht, dass der Vertriebspartner zumindest Anhaltspunkte für solche Umstände darlegen kann (wir berichteten im Update Commercial 03/2017). Diese Auslegung widerspricht nach Ansicht des OLG Frankfurt jedoch Sinn und Zweck der gesetzlichen Neuregelung, nach der der Ausgleichsanspruch sich primär nach den Unternehmervorteilen berechne und nicht mehr allein auf die Provisionsverluste beschränkt sei.
Das OLG Düsseldorf hatte in seiner einen generellen Auskunftsanspruch des Vertriebspartners ablehnenden Entscheidung einen differenzierteren Ansatz verfolgt, der auch die Unternehmerinteressen im Blick behielt. So hat es insbesondere den Auskunftsanspruch verneint, wenn der Ausgleichsanspruch bei einer Berechnung nach der „traditionellen“ Methode bereits den gesetzlichen Höchstbetrag überschreitet oder wenn die Auskunft vom Vertriebspartner lediglich ins Blaue hinein oder als Druckmittel verlangt wird. Das OLG Frankfurt setzt sich in seiner Entscheidung mit derartigen Konstellationen nicht auseinander, bejaht aber grundsätzlich einen Auskunftsanspruch in Bezug auf die Unternehmervorteile, ohne dass konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen müssen, dass diese Vorteile die Provisionsverluste des Vertriebspartners übersteigen. Dies führt in der Praxis nicht nur zu einem erheblichen Mehraufwand für Unternehmer, sondern zwingt sie u. U. auch, „ohne Not“ Auskünfte über Geschäftsgeheimnisse zu erteilen. Das OLG Frankfurt hat die Revision zugelassen, diese ist derzeit beim BGH anhängig (Az. VII ZR 69/19). Es bleibt daher abzuwarten, wie die höchstrichterliche Entscheidung in dieser Streitfrage ausfallen wird.
Fehlende Kennzeichnung von Elektrogeräten mit „durchgestrichener Tonne“ kann abgemahnt werden
(OLG Frankfurt, Urteil v. 25. Juli 2019 – 6 U 51/19)
- Hersteller und Importeure von Elektrogeräten, die auf ihren Produkten nicht vorschriftsgemäß das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ anbringen, mit dem deutlich gemacht wird, dass die Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, können nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt von Wettbewerbern abgemahnt werden.
- Die entsprechende Vorschrift des Elektrogesetzes (ElektroG) verfolge zwar in erster Linie abfallwirtschaftliche Ziele. Die Kennzeichnungspflicht diene jedoch mittelbar auch dem Verbraucherschutz, da die Verbraucher ein Interesse daran hätten, bereits beim Kauf erkennen zu können, dass sie das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen können. Es handele sich danach um eine Marktverhaltensregelung, bei deren Nichteinhaltung Wettbewerber Unterlassungsansprüche geltend machen können.
Ob es sich bei den Kennzeichnungsvorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte um (abmahnfähige) Marktverhaltensregelungen handelt, war in der Rechtsprechung in der Vergangenheit umstritten. Teilweise wurden Unterlassungsansprüche von Wettbewerbern unter Berufung darauf, dass die entsprechenden Vorgaben vorrangig dem Umweltschutz dienten, abgelehnt. Der Gesetzgeber hat 2015 bei der Neufassung des ElektroG jedoch klargestellt, dass das Gesetz zur Erreichung seiner abfallwirtschaftlichen Ziele (auch) das Marktverhalten der verpflichteten Unternehmer regeln soll. Verstöße gegen das ElektroG können daher nicht nur empfindliche Bußgelder von bis zu EUR 100.000 nach sich ziehen, sondern auch Abmahnungen von Wettbewerbern hervorrufen.
Transportrechtlicher CMR-Gerichtsstand gilt auch für Direktansprüche gegen Haftpflichtversicherer
(BGH, Urteil v. 29. Mai 2019 – I ZR 194/18)
- Der BGH hat entschieden, dass die internationale Gerichtsstandsbestimmung des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, kurz: CMR) zugunsten der Gerichte des Staates, auf dessen Gebiet der Ort der Übernahme des Gutes oder der für die Ablieferung vorgesehene Ort liegt, auch für Direktansprüche des Absenders oder Empfängers gegen den Haftpflichtversicherer des Frachtführers gilt.
- Die Anwendung der Vorschrift sei nicht auf sich aus der CMR ergebende vertragliche Ansprüche beschränkt. Sie gelte vielmehr auch für vertragliche und außervertragliche Ansprüche, die auf ergänzend anwendbare nationale Bestimmungen gestützt werden, sofern diese Ansprüche auf einer der CMR unterliegenden Beförderung beruhen.
- Soweit Bestimmungen der CMR auch für Ansprüche von Personen gälten, die nicht als Absender, Frachtführer oder Empfänger am Beförderungsvertrag beteiligt sind, sei der transportrechtliche Gerichtsstand auch für diese Ansprüche eröffnet, sofern sie mit dem Beförderungsvertrag noch in einem hinreichend engen Zusammenhang stehen. Dies sei jedenfalls bei Ansprüchen von und gegen Personen, die an der Beförderung als solcher unmittelbar beteiligt waren, aber auch bei Direktansprüchen gegen den Versicherer einer dieser Parteien der Fall.
Die Entscheidung ist sachgerecht, da sie es den Beteiligten ermöglicht, mehrere aus demselben Beförderungsvertrag herrührende Streitigkeiten vor den Gerichten eines einzigen Vertragsstaates abzuwickeln. Der BGH führt als Argument für diese Bündelung an einem Gerichtsstand vor allem die ansonsten drohende Gefahr divergierender Urteile aus verschiedenen Staaten an. Für die betroffenen Unternehmen dürfte sie aber daneben regelmäßig auch zu einer deutlichen Verringerung des Gesamtaufwandes führen, wenn neben dem Vertragspartner zugleich auch dessen Haftpflichtversicherer in Anspruch genommen werden soll.
Bundeskartellamt nennt Kriterien zur kartellrechtlichen Beurteilung von Bieter- und Liefergemeinschaften
(BKartA, Fallbericht v. 10. April 2019, B1-189/13, B1-11/15)
- Das Bundeskartellamt hat in einem Verfahren gegen Hersteller von Asphaltmischgut eine Geldbuße von rund EUR 1,4 Mio. erlassen. Es waren zahlreiche Liefergemeinschaften gebildet worden, die nach Auffassung des Bundeskartellamts auf unzulässige Gebiets-, Kunden- und Mengenaufteilungen einschließlich Preisabsprachen hinausliefen.
- Parallel zum Abschluss dieses Bußgeldverfahrens hat das Bundeskartellamt den Deutschen Asphaltverband bei der Prüfung der kartellrechtlichen Zulässigkeit von Liefergemeinschaften begleitet. Die vom Verband verabschiedeten Leitlinien wurden vom Kartellamt „abgesegnet“. Danach ist es zulässig, mit einem Wettbewerber eine Liefergemeinschaft einzugehen, wenn drei Anforderungen erfüllt sind:
- Das Unternehmen, das erwägt, eine Liefergemeinschaft einzugehen, ist allein nicht in der Lage, ein eigenes Angebot abzugeben.
- Die Kooperation ist wirtschaftlich zweckmäßig und kaufmännisch vernünftig.
- Erst die Kombination der eigenen Ressourcen mit den Ressourcen des Wettbewerbers erlaubt die Abgabe eines Angebotes.
Der Bundesgerichtshof hat bereits in seiner Schramberg-Entscheidung vom 13. Dezember 1983 – KRB 3/83 – wesentliche Weichenstellungen für die kartellrechtliche Beurteilung einer Bieter- und Liefergemeinschaft vorgenommen. Danach ist geklärt, dass die Beteiligung an einer Bieter- und Liefergemeinschaft dann zulässig ist, wenn die Unternehmen erst durch die Bildung dieser Gemeinschaft in die Lage versetzt werden, ein Angebot abzugeben (sog. Arbeitsgemeinschaftsgedanke).
Weniger klar ist, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Bieter- und Liefergemeinschaft auch dann kartellrechtlich erlaubt ist, wenn ihre Bildung (nur) wirtschaftlich zweckmäßig und kaufmännisch vernünftig erscheint. Die Rechtsprechung gewährt den beteiligten Unternehmen insoweit einen gewissen Ermessensspielraum, während das Bundeskartellamt darauf Wert legt, dass sich dies nach rein objektivierten Kriterien entscheiden müsse. Von daher sind die Spielräume in der Praxis ansatzweise weiter, als es sich aus den obigen BKartA-Kriterien ergibt.
Außerdem kann eine grundsätzlich wettbewerbsbeschränkende Bieter- und Liefergemeinschaft nach den Einzelfreistellungskriterien des Artikel 101 Abs. 3 AEUV bzw. § 2 GWB freigestellt sein. Das muss im Einzelfall geprüft werden.
Schließlich ist zu beachten, dass der im Rahmen einer zulässigen Bieter- und Liefergemeinschaft praktizierte Informationsaustausch zu limitieren ist. Auf einen Nenner gebracht, muss sich der Informationsaustausch auf die Angaben beschränken, die zur Abstimmung eines gemeinsamen Angebots unbedingt notwendig sind. Dazu gehört definitiv nicht, seine generellen Kalkulationsgrundlagen offenzulegen oder gar geheime Preise oder Preisbestandteile für andere Objekte mitzuteilen.
Gesetzgebung und Trends
Neue Regelungen für mehr Sicherheit bei Onlinezahlungen
- Seit dem 14. September 2019 gelten neue Regelungen für Onlinezahlungen, die den elektronischen Zahlungsverkehr sicherer machen sollen. Die überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (RL [EU] 2015/2366, engl. Payment Services Directive, kurz: PSD2), die in Deutschland durch das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz umgesetzt wurde, sieht hierfür vor allem die verbindliche Einführung einer „starken Kundenauthentifizierung“, auch „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ genannt, für alle Zahlungen über 30 Euro vor.
- Für die Umsetzung der neuen Anforderungen in die Praxis besteht derzeit allerdings teilweise noch erheblicher Anpassungsbedarf. Aus diesem Grund hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitgeteilt, Kreditkartenzahlungen im Internet, die weiterhin ohne starke Kundenauthentifizierung angeboten werden, vorerst nicht zu beanstanden. Dadurch sollen Störungen bei Internet-Zahlungen verhindert und ein möglichst reibungsloser Übergang auf die neuen Anforderungen der PSD2 ermöglicht werden. Diese Erleichterungen sind zeitlich befristet, eine konkrete Übergangsfrist wurde bislang allerdings noch nicht festgelegt.
Die neuen Vorschriften beinhalten zwar keine unmittelbaren Verpflichtungen für Onlinehändler, sondern richten sich primär an Zahlungsdiensteanbieter. Onlinehändler, die bislang noch keine PSD2-konforme Zahlungsmöglichkeiten anbieten, sollten sich diesbezüglich trotzdem zeitnah mit ihren Zahlungsdienstleistern in Verbindung setzen, um die Möglichkeiten der Umsetzung der neuen Anforderungen zu erörtern und so künftigen Problemen bei der Zahlungsabwicklung vorzubeugen.
Ab 2020 verbesserte gegenseitige Anerkennung von Waren in der EU
- Ab dem 19. April 2020 gilt die neue EU-Verordnung zur gegenseitigen Anerkennung von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind. Die ist Teil des sog. EU-Warenpakets, zu dem auch die „Verordnung über Produktkonformität und Marktüberwachung“ (wir berichteten im Update Commercial 08/2018) gehört, und soll die Einhaltung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs innerhalb der EU sichern.
- Herstellern und Importeuren von Produkten, für die keine EU-weit harmonisierten Produktvorschriften gelten (wie z. B. Möbel, Kleidungsstücke und Lebensmittel), aber auch Händlern, die solche Produkte vertreiben, wird häufig der Verkauf in andere Mitgliedstaaten von den dortigen Behörden bereits deshalb untersagt, weil die dort geltenden produktspezifischen Vorschriften nicht eingehalten werden – unabhängig davon, ob dies zu einem Risiko für die Erwerber führt oder nicht.
- Nach der neuen Verordnung haben die Hersteller derartiger Produkte ab April 2020 die Möglichkeit, den Behörden durch Vorlage eines vereinheitlichten Formulars nachzuweisen, dass die Waren in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht wurden. Die Behörden dürfen dann den Vertrieb der Ware in ihrem Mitgliedstaat nur noch untersagen, wenn hierfür ein berechtigtes öffentliches Interesse (wie z. B. konkrete Sicherheits- oder Gesundheitsbedenken) besteht. Für den Fall einer als unberechtigt angesehenen Untersagung sieht die Verordnung ein vereinheitlichtes außergerichtliches Problemlösungsverfahren vor.
Die neuen Regelungen sollen insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen den Vertrieb ihrer Produkte in andere EU-Mitgliedstaaten erleichtern. Für Unternehmen, die Produkte herstellen, importieren oder vertreiben, für die keine oder nur teilweise harmonisierte Produktvorschriften bestehen, dürfte es sich für den Vertrieb ins EU-Ausland daher lohnen, sich mit den neuen Regelungen vertraut zu machen.