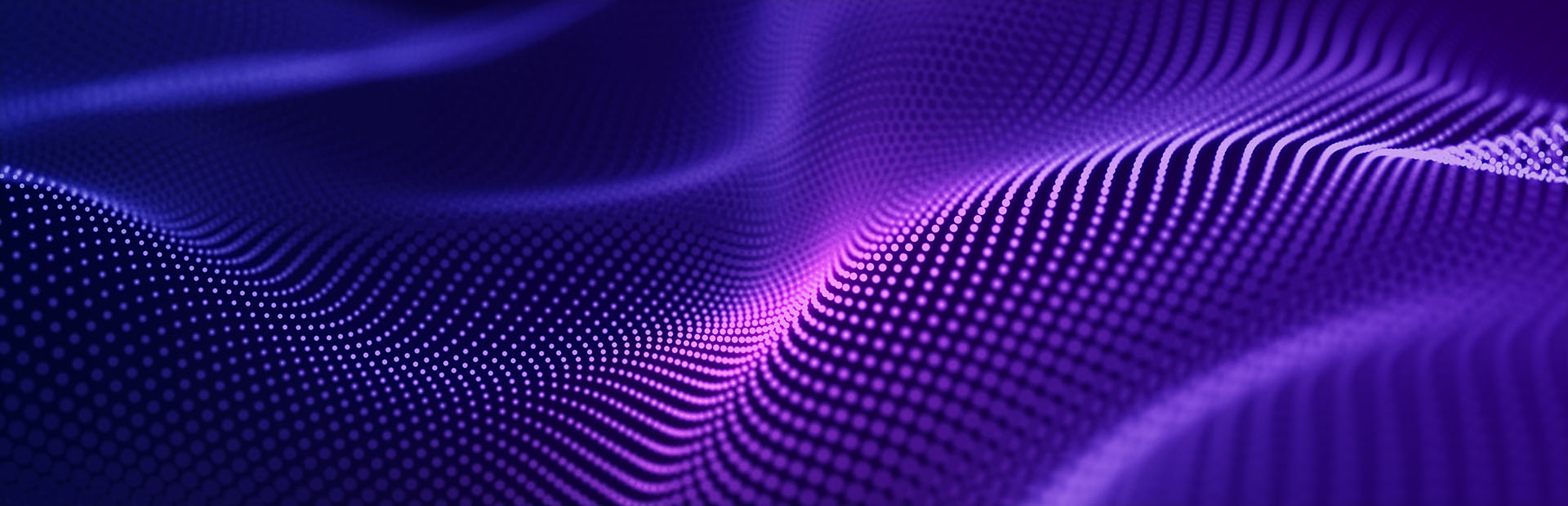Update Commercial 10/2021

Autoren
Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe unseres Updates liegt auf dem Vertriebsrecht: Unter anderem geht es um die Frage, ob Software als „Ware“ im Sinne der Handelsvertreter-Richtlinie anzusehen ist und welche Handlungsmöglichkeiten Unternehmer gegenüber ihren Handelsvertretern haben, wenn sie selbst ihre Vertriebsrechte verlieren. Außerdem hat der BGH die Voraussetzungen konkretisiert, unter denen Verkäufer auch für fremde öffentliche Äußerungen haften, und das OLG Bamberg befasste sich kritisch mit Schadenspauschalen in AGB.
Eine Auswahl der Themen dieser Ausgabe behandelt auch die aktuelle Folge unseres Podcasts CMS To Go – Update Commercial. Hören Sie gerne einmal rein!
Außerdem möchten wir Sie auf eine anstehende Veranstaltung hinweisen: Am 23. November 2021 um 10.00 Uhr geben Dr. Christoph Schröder und Prof. Dr. Martin Schulz im Rahmen unserer Webinar-Reihe „Compliance Sessions 2021“ einen Überblick über „Neue Sorgfaltspflichten in der Lieferkette“. Themen werden das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und die geplante EU-Richtlinie sein. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.
Inhalt
Im Folgenden finden Sie die Themen des Newsletters.
Aktuelle Rechtsprechung
- Tippfehler mit Folgen – keine Produkthaftung für unrichtigen Gesundheitstipp in einem Zeitungsartikel
- Ausschluss der Verkäuferhaftung für öffentliche Äußerungen nur in engen Ausnahmefällen möglich
- Garantiehaftung und „garantierte Lieferzeit“ in AGB
- Software ist „Ware“ i. S. d. Handelsvertreter-Richtlinie
- Verlust der Vertriebsrechte des Prinzipals rechtfertigt außerordentliche (aber nicht fristlose) Kündigung gegenüber Handelsvertreter
- Ehemaliger Vertragshändler darf Marke nicht als Teil der neuen Unternehmensbezeichnung nutzen
Gesetzgebung & Trends
- Brexit: CE-Kennzeichnung wird in Großbritannien länger anerkannt
- EU-Vorschlag für einheitliches Ladegerät für elektronische Geräte
Bei Interesse können Sie das Update Commercial hier abonnieren.
Podcast CMS To Go – Update Commercial: Herbst 2021
Dr. Ulrich Becker und Dr. Robert Budde, beide Partner bei CMS im Bereich Commercial, berichten unter anderem über aktuelle Urteile zum Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters, den pauschalen Schadensersatz in AGB und eine wegweisende Entscheidung zur Produkthaftungsrichtlinie – ausgelöst durch einen fatalen Schreibfehler. Außerdem diskutieren sie darüber, inwiefern der Vertrieb von Software unter die Handelsvertreterrichtlinie fällt.
Aktuelle Rechtsprechung
Tippfehler mit Folgen – keine Produkthaftung für unrichtigen Gesundheitstipp in einem Zeitungsartikel
(EuGH, Urteil v. 10. Juni 2021 – C-65/20)
- Der EuGH hat sich in einem aktuellen Verfahren mit der Frage befasst, ob unzutreffende Informationen in einem Zeitungsartikel die Zeitung, in der der Artikel erschienen ist, zu einem fehlerhaften Produkt im Sinne der Produkthaftungsrichtlinie machen und so eine verschuldensunabhängige Haftung des Herstellers für daraus entstehende Schäden begründen können.
- In dem in Rede stehenden Artikel in der Gesundheitsrubrik einer österreichischen Zeitung wurde empfohlen, Rheumaschmerzen mithilfe einer Auflage aus geriebenem Meerrettich zu lindern, die „zwei bis fünf Stunden“ angewendet werden könne. Richtig hätte es jedoch „zwei bis fünf Minuten“ heißen müssen. Eine Leserin beließ eine solche Auflage ca. drei Stunden auf der Haut, was zu einer schmerzhaften toxischen Hautreaktion führte. Hierfür verlangte sie Schadenersatz von dem Verlag, bei dem die Zeitung erschienen war.
- Der EuGH verneinte jedenfalls eine Haftung nach der Produkthaftungsrichtlinie, da eine solche verschuldensunabhängige Herstellerhaftung nur für fehlerhafte Produkte, d. h. bewegliche Sachen, in Betracht komme. Bei dem fehlerhaften Gesundheitstipp handele es sich um eine Dienstleistung, die auch dann, wenn sie in eine gedruckte Zeitung als bewegliche Sache aufgenommen wird, diese Zeitung nicht zu einem fehlerhaften Produkt im Sinne der Richtlinie mache. Die Fehlerhaftigkeit eines Produkts werde anhand bestimmter Faktoren ermittelt, die dem Produkt selbst innewohnen. Da sich der unrichtige Ratschlag nicht auf die gedruckte Zeitung beziehe, gehöre er nicht zu den ihr innewohnenden Faktoren. Insofern komme weder eine Haftung des Verlags noch der Druckerei oder des Autors des fehlerhaften Artikels nach der Produkthaftungsrichtlinie in Betracht.
Praxistipp: Die Entscheidung bringt Klarheit für die in der juristischen Literatur seit langem umstrittene Frage, inwieweit fehlerhafte geistige Leistungen, die auf bestimmten Informationsträgern verkörpert werden, Produkthaftungsansprüche begründen können. Nach dem EuGH beschränkt sich die Produkthaftung in derartigen Fällen auf Schäden, die durch die Gefährlichkeit des Informationsträgers als solchen (wie beispielsweise giftige Druckfarbe, scharfkantige Datenträger, o. Ä.) verursacht werden. Der gegenteiligen Ansicht, die eine Produkthaftung auch für unrichtige Inhalte von Informationsträgern befürwortet, da diese in der Regel gerade wegen dieser Inhalte erworben würden und sich die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher an das Produkt auch auf die Inhalte erstrecken, erteilte das Gericht damit eine Absage.
Neben fehlerhaften Informationen in Druckwerken ist diese Frage insbesondere auch im Hinblick auf fehlerhafte Software relevant. Dass die Haftungsregelungen der aus dem Jahr 1985 stammenden Produkthaftungsrichtlinie teilweise nicht mehr ideal auf die heutigen Gegebenheiten passen, hat auch der Europäische Gesetzgeber erkannt und daher in diesem Jahr eine Initiative zur Anpassung der zivilrechtlichen Haftungsregeln an das digitale Zeitalter und an die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorgestellt. Mit einer entsprechenden Überarbeitung oder Ablösung der derzeitigen Richtlinie ist demzufolge im dritten Quartal des Jahres 2022 zu rechnen.
Ausschluss der Verkäuferhaftung für öffentliche Äußerungen nur in engen Ausnahmefällen möglich
(BGH, Urteil v. 16. Juli 2021 – V ZR 119/20)
- Für die Beurteilung, ob eine Kaufsache mangelhaft ist, kommt es nicht nur darauf an, welche Beschaffenheit zwischen den Kaufvertragsparteien vereinbart wurde, sondern der Verkäufer hat unter anderem auch dafür einzustehen, dass die Sache diejenigen Eigenschaften aufweist, die der Käufer nach bestimmten öffentlichen Äußerungen (z. B. im Rahmen der Produktgestaltung oder der Werbung) erwarten kann. Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Die Haftung für solche öffentlichen Äußerungen ist beispielsweise ausgeschlossen, wenn diese die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnten.
- Im Hinblick auf diese Ausnahme hat der BGH klargestellt, dass Verkäufer sich nur hierauf berufen können, wenn ein Einfluss der öffentlichen Äußerung auf die Kaufentscheidung nachweislich ausgeschlossen werden kann. Dabei sind an diesen Nachweis hohe Anforderungen zu stellen.
- Da es für eine Beeinflussung der Kaufentscheidung genüge, dass der Käufer die öffentliche Äußerung in seine Abwägung für und gegen den Kauf einbezogen hat, sei ein Ausschluss der Beeinflussung etwa dann anzunehmen, wenn die öffentliche Äußerung bei Vertragsschluss noch nicht vorlag oder sie zwar vorlag, der Käufer sie aber nicht kannte, oder wenn es dem Käufer bei dem Vertragsschluss – nachweislich – allein auf eine Beschaffenheit oder einen Verwendungszweck ankam, für den die in der öffentlichen Äußerung behandelten Umstände ohne Bedeutung waren.
- Zudem stellte der BGH klar, dass mit „Kaufentscheidung“ der Abschluss des Kaufvertrags gemeint sei. Sei der Käufer zum Kauf entschlossen, der Kaufvertrag aber noch nicht abgeschlossen, sei eine Kaufentscheidung im Sinne der maßgeblichen Vorschrift noch nicht gegeben, da im Rahmen der Privatautonomie jede Partei bis zum Vertragsschluss das Recht habe, von dem in Aussicht genommenen Vertrag Abstand zu nehmen.
Praxistipp: Die Verkäuferhaftung auch für öffentliche Äußerungen betrifft nicht nur derartige Äußerungen des Verkäufers selbst, sondern auch solche des Herstellers der Sache sowie von Gehilfen, wenn der Verkäufer diese kannte oder kennen musste. Neben dem u. U. schwierigen Nachweis, dass die Äußerung die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte, kann der Verkäufer die Haftung nur ausschließen, wenn er die öffentliche Äußerung vor Vertragsschluss „in gleichwertiger Weise“ berichtigt. Hierzu hat der BGH bereits entschieden, dass dies einen klaren Hinweis des Verkäufers voraussetzt, dass eine bestimmte öffentliche Äußerung unrichtig ist. Nicht ausreichend ist, dass sich aus übergebenen Unterlagen oder verkäuferseitigen Aussagen für den Käufer Zweifel an der Richtigkeit der öffentlichen Angaben ergeben könnten. Verkäufern ist daher zu raten, nicht nur im Hinblick auf eigene Äußerungen zur Kaufsache Sorgfalt walten zu lassen, sondern auch derartige Äußerungen der Hersteller kritisch zu hinterfragen, um ggf. diesbezügliche Kundenerwartungen rechtzeitig dämpfen zu können.
Übrigens: Dem Versuch, die Haftung für öffentliche Äußerungen mittels einer AGB-Klausel auszuschließen, erteilte kürzlich das OLG Hamm eine Absage (OLG Hamm, Urteil v. 19. August 2021 – 4 U 57/21). Die in einem B2B-Vertrag enthaltene Klausel „Die vereinbarte Beschaffenheit unserer Waren wird ausschließlich durch unsere Produktbeschreibungen bestimmt. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen und Werbungen stellen daneben keine vertragsgemäßen Beschaffenheitsangaben dar“ erachtete das Gericht als unwirksam, da sie es der Verkäuferseite praktisch ermögliche, die Beschaffenheit der Waren abweichend von jeglicher Werbung, Anpreisung u. Ä. – im Zweifel zum eigenen Vorteil – zu definieren und hierdurch Gewährleistungsansprüche der Kunden gewissermaßen beliebig einzuschränken. Dies könne auch im unternehmerischen Verkehr nicht hingenommen werden (gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern wäre eine entsprechende Regelung ohnehin unzulässig).
Garantiehaftung und „garantierte Lieferzeit“ in AGB
(OLG Bamberg, Urteil v. 5. März 2021 – 3 U 68/20)
- Das OLG Bamberg hat eine Klausel in den Einkaufsbedingungen eines Einkaufsverbandes der Möbelbranche für unwirksam erklärt, die die Lieferanten bei jeder Überschreitung der vereinbarten Lieferzeit – unabhängig von einem Verschulden – zur Zahlung von pauschaliertem Schadenersatz in Höhe eines prozentualen Anteils des Rechnungsnettobetrages verpflichtete.
- Da es zu den allgemeinen Grundsätzen des Haftungsrechts gehöre, dass eine Verpflichtung zum Schadensersatz regelmäßig nur bei schuldhaftem Verhalten besteht, könne eine verschuldensunabhängige (Garantie-)Haftung in allgemeinen Geschäftsbedingungen nur ausnahmsweise wirksam vereinbart werden. Denkbar sei dies insbesondere, wenn die verschuldensunabhängige Haftung durch höhere Interessen des AGB-Verwenders gerechtfertigt sei oder durch Gewährung anderweitiger rechtlicher Vorteile ausgeglichen werde. Dies gelte auch für den Ersatz von Verzögerungsschäden bei der Überschreitung von Lieferfristen, da es auch hier zu den wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Verzugsregelungen gehöre, dass eine Verzugshaftung Verschulden an der Verzögerung voraussetze.
- Allein der Umstand, dass das Risiko der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeiten durch die Lieferanten käuferseitig nicht beherrschbar oder beeinflussbar ist, rechtfertige eine derart weitreichende verschuldensunabhängige Haftung nicht, da auch nach den gesetzlichen Regelungen selbst bei einem Fixgeschäft Schadensersatz statt der Leistung nur verschuldensabhängig zu leisten sei.
- Eine Klausel, nach der die vereinbarten Lieferzeiten „garantiert“ und die Käufergesellschaften bei Überschreitung zum Rücktritt berechtigt sein sollten, befand das OLG Bamberg hingegen für wirksam. Durch die Regelung werde ein Fixgeschäft begründet. Derartige AGB-Klauseln werden zwar in Fällen, in denen der Vertragspartner nicht damit rechnen muss, dass das Geschäft mit der Fristeinhaltung stehen oder fallen soll, vom BGH an sich kritisch gesehen. Etwas anderes könne aber gelten, wenn Fixgeschäfte in der betroffenen Branche üblich sind. Das OLG Bamberg ging hier für die Möbelbranche von einer solchen Branchenüblichkeit aus und ließ die Regelung daher unbeanstandet.
Praxistipp: Die Entscheidung verdeutlicht einmal mehr den auch bereits vom BGH herausgestellten Grundsatz, dass eine verschuldensunabhängige Haftung des Vertragspartners nur in sehr engen Grenzen über AGB begründet werden kann. Daneben sind bei der Gestaltung von Haftungsklauseln – abhängig davon, ob es sich um pauschalierten Schadenersatz oder eine Vertragsstrafenregelung handelt – auch weitere Anforderungen des AGB-Rechts zu beachten. Im Hinblick auf die Frage, ob in Einkaufsbedingungen wirksam zulasten des Vertragspartners ein Fixgeschäft vereinbart werden kann, ist nach dem Urteil des OLG Bamberg auf die Branchenüblichkeit derartiger Regeln abzustellen. Hier empfiehlt es sich, entsprechende Überlegungen bereits bei der Vertragsgestaltung anzustellen, um im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung idealerweise unmittelbar Nachweise für eine solche Branchenüblichkeit vorlegen zu können.
Software ist „Ware“ i. S. d. Handelsvertreter-Richtlinie
(EuGH, Urteil v. 16. September 2021 – C-410/19)
- Der EuGH hat entschieden, dass der Begriff „Verkauf von Waren“ im Sinne der europäischen Handelsvertreter-Richtlinie auch den Vertrieb von Software umfassen kann – unabhängig davon, ob die Software auf einem Datenträger gespeichert ist oder online verfügbar gemacht und den Kunden eine unbefristete Lizenz zur Nutzung erteilt wird. Somit sind Personen, die als selbständige Gewerbetreibende ständig mit der Vermittlung solcher Verträge betraut sind, als Handelsvertreter im Sinne der Richtlinie anzusehen.
- Hintergrund des Verfahrens war eine Auseinandersetzung zweier britischer Unternehmen, da in Großbritannien – anders als in Deutschland –, dem Wortlaut der Handelsvertreter-Richtlinie entsprechend, die Vermittlung des „Verkaufs oder Ankaufs von Waren“ Voraussetzung für die Einstufung als Handelsvertreter ist.
- Der EuGH entschied, dass der Begriff des „Verkaufs von Waren“ autonom auszulegen sei. Die Richtlinie unterscheide für den Begriff der Ware nicht zwischen körperlichen oder unkörperlichen Gegenständen und auch die Ziele der Richtlinie, die Interessen der Handelsvertreter zu schützen und den internationalen Warenverkehr zu erleichtern, geböten eine Einbeziehung auch der Vermittlung von Softwareverträgen.
Praxistipp: Für Vertriebsverhältnisse, die deutschem Recht unterliegen, bringt die Entscheidung des EuGH wenig Neues, da in Deutschland für die Einstufung als Handelsvertreter – anders als nach der insoweit engeren Handelsvertreter-Richtlinie – lediglich die ständige Betrauung mit der „Vermittlung von Geschäften“ (oder deren Abschluss im Namen des Unternehmers) gefordert wird, worunter sowohl Waren als auch Dienstleistungen fallen. Relevant ist das Thema jedoch für Vertreiber von Software für ausländische Unternehmen, wenn das Recht, nach dem der Vertriebsvertrag zu beurteilen ist, entsprechend den Mindestvorgaben der EU-Richtlinie für den Handelsvertreterbegriff auf den Verkauf von Waren abstellt. Hier können sich die Vertriebsmittler mit dem EuGH auf den Schutz der Richtlinie berufen und so insbesondere nach Vertragsbeendigung gegebenenfalls einen Ausgleichsanspruch geltend machen. In einer Gesamtbetrachtung mit der sogenannten Ingmar-Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2000 dürfte dies sogar dann gelten, wenn der Vertriebsvertrag nach einem außereuropäischen Recht geschlossen wurde, das gar keine Schutzvorschriften zugunsten der Handelsvertreter kennt, die Vertriebstätigkeit aber in der EU stattfindet. Darin hatte der EuGH entschieden, dass das Mindestschutzniveau der Handelsvertreter-Richtlinie für alle in der EU tätigen Handelsvertreter gelten müsse und nicht durch eine Rechtswahl im Vertrag umgangen werden könne.
Verlust der Vertriebsrechte des Prinzipals rechtfertigt außerordentliche (aber nicht fristlose) Kündigung gegenüber Handelsvertreter
(OLG München, Beschluss v. 26. Oktober 2020 – 7 U 4016/20)
- Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung eines Handelsvertretervertrages durch den Prinzipal kann nach einer Entscheidung des OLG München auch dann gegeben sein, wenn der Prinzipal seinerseits die Vertriebsrechte für die vertriebenen Produkte verliert.
- Ein Grund für eine solche außerordentliche Kündigung ist immer dann gegeben, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Handelsvertretervertrags bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist. Das OLG München stellte dabei klar, dass der wichtige Grund dabei, auch dann, wenn der Prinzipal den Handelsvertretervertrag kündigt, aus der Sphäre des Prinzipals stammen kann.
- Hierbei betonte das Gericht, dass auch dann, wenn ein wichtiger Kündigungsgrund bestehe, der Prinzipal jedoch – abhängig von den Umständen des Einzelfalls – nach Treu und Glauben zur Einhaltung einer angemessenen Übergangsfrist (die aber nicht der ordentlichen Kündigungsfrist entsprechen müsse) verpflichtet sein könne. Im streitgegenständlichen Fall, dem eine elfjährige Geschäftsbeziehung zwischen Prinzipal und Handelsvertreter vorausgegangen war, erachtete das OLG München die eingehaltene Frist von zwei Monaten hierfür als ausreichend.
Praxistipp: Das OLG München erkennt in seinem Urteil grundsätzlich das Interesse des Prinzipals an, sich gegebenenfalls auch kurzfristig von Handelsvertretern trennen zu können, wenn er aufgrund betrieblicher Entscheidungen die Vertragswaren nicht länger vertreiben kann oder will. Für die Frage, mit welchem Vorlauf die Handelsvertreter von dieser Entscheidung in Kenntnis zu setzen sind und ob dem Prinzipal dabei nicht doch die Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist zugemutet werden kann, sind jedoch stets die individuellen Umstände zu berücksichtigen. Neben der Dauer der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Handelsvertreter (die auch für die Bestimmung der ordentlichen Kündigungsfrist entscheidend ist) ist auch zu beachten, wie lange der Prinzipal bereits Absichten zur Umgestaltung seines Vertriebssystems hegte oder wann er von Gründen, die zum Verlust seiner Vertriebsrechte führen können, Kenntnis erlangt hat. Grundsätzlich empfiehlt es sich vor diesem Hintergrund, die Handelsvertreter möglichst frühzeitig von den beabsichtigten Veränderungen in Kenntnis zu setzen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit ausreichend Vorlauf auf die neue Situation einzustellen.
Ehemaliger Vertragshändler darf Marke nicht als Teil der neuen Unternehmensbezeichnung nutzen
(OLG Frankfurt, Urteil v. 12. August 2021 – 6 U 102/20)
- Das OLG Frankfurt a. M. hat einem ehemaligen Vertragshändler eines bekannten Motorrad-Herstellers untersagt, die Marke des Unternehmens nach Beendigung des Vertriebsverhältnisses weiter im Rahmen seiner Unternehmensbezeichnung zu nutzen.
- Der ehemalige Vertragshändler bezeichnete sich u. a. nach Beendigung der Händlerbeziehung in seinem Internetauftritt unter Nennung des Markennamens des Unternehmens als „Nachfolgegesellschaft der [Marke]-Vertretung“. Das Unternehmen ging daraufhin gegen den ehemaligen Vertragspartner vor und forderte ihn auf, jegliche Nutzung der Marke einzustellen (wozu er auch nach dem Händlervertrag nach Vertragsbeendigung verpflichtet war).
- Der Händler berief sich auf eine gesetzliche Ausnahmeregelung, die es Dritten unter Umständen erlaubt, eine fremde Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Markeninhabers zu benutzen, da er weiterhin mit gebrauchten Motorrädern des Herstellers handelte. Das OLG Frankfurt erachtete die Voraussetzungen dieser Ausnahme jedoch nicht als erfüllt, da hierfür erforderlich sei, dass die (weitere) Markennutzung das einzige Mittel darstelle, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Werbende spezialisiert auf den Handel von Waren mit dieser Marke ist. Eine Firmierung als „Nachfolgegesellschaft der [Marke]-Vertretung“ sei jedoch für einen solchen Hinweis nicht erforderlich.
Praxistipp: Um einer unerwünschten Nutzung der eigenen Marke durch ehemalige Vertriebspartner nach der Beendigung des Vertriebsverhältnisses vorzubeugen, empfiehlt es sich für Hersteller, entsprechende Regelungen für die Zeit nach der Vertragsbeendigung in die Vertriebsverträge aufzunehmen. In diesem Fall ist die zulässige Weiternutzung der Marke durch den Vertriebspartner nur noch unter engen Voraussetzungen zulässig.
Gesetzgebung & Trends
Brexit: CE-Kennzeichnung wird in Großbritannien länger anerkannt
- Seit Ablauf der Brexit-Übergangsphase Ende 2020 gelten für die Bereitstellung von Produkten auf dem britischen Markt neue Vorgaben. Insbesondere ersetzt seit dem 1. Januar 2021 das „UK Conformity Assessed Mark“ (das sogenannte „UKCA marking“) grundsätzlich die europäische CE-Kennzeichnung.
- Für viele Produkte besteht jedoch eine Übergangfrist, innerhalb derer Produkte für den britischen Markt auch weiterhin mit dem CE-Kennzeichen versehen werden können. Diese Übergangsfrist sollte zunächst ein Jahr betragen, die britische Regierung hat jedoch am 24. August 2021 mitgeteilt, dass die Übergangsregelung um ein Jahr verlängert wurde.
- Die ausschließliche Verwendung der UKCA-Kennzeichnung wird für die betroffenen Produkte damit erst ab dem 1. Januar 2023 verpflichtend. Die von der britischen Regierung veröffentlichten Leitlinien für die Bereitstellung von Produkten in Großbritannien ab dem 1. Januar 2021 wurden entsprechend aktualisiert.
Praxistipp: Den betroffenen Unternehmen wird durch die Verlängerung der Übergangsfrist mehr Zeit gewährt, sich mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Einen Überblick über die Produktkennzeichnung in Großbritannien nach dem Brexit bietet unser Blogbeitrag Brexit = CExit? Produktkennzeichnung in Großbritannien ab 2021.
EU-Vorschlag für einheitliches Ladegerät für elektronische Geräte
(Pressemitteilung der EU-Kommission v. 23. September 2021)
- Die EU-Kommission schlägt neue Rechtsvorschriften für ein einheitliches Ladegerät für elektronische Geräte vor. Danach soll USB-C zum Standardanschluss für alle Smartphones, Tablets, Kameras, Kopfhörer, tragbaren Lautsprecher und tragbaren Videospielkonsolen werden. Ziel der Regelung soll mehr Verbraucherfreundlichkeit bei gleichzeitiger Verringerung des ökologischen Fußabdrucks im Zusammenhang mit der Herstellung und Entsorgung von Ladegeräten sein.
- Die dafür von der Kommission vorgeschlagene Änderung der Funkanlagenrichtlinie enthält ebenfalls Vorgaben zur Harmonisierung von Schnellladetechnologie, die erreichen sollen, dass einzelne Hersteller die Ladegeschwindigkeit nicht ungerechtfertigt begrenzen und dass die Ladegeschwindigkeit bei der Verwendung eines kompatiblen Ladegeräts identisch ist. Zudem soll der Verkauf von Ladegeräten und elektronischen Geräten entbündelt und Unternehmer sollen verpflichtet werden, einschlägige Informationen über die Ladeleistung, etwa über die vom Gerät benötigte Leistung, bereitzustellen sowie Angaben dazu zu machen, ob die Schnellladung unterstützt wird. So sollen Verbraucherinnen und Verbraucher besser nachvollziehen können, ob ihre bisherigen Ladegeräte den Anforderungen ihres neuen Geräts entsprechen, oder leichter ein kompatibles Ladegerät auswählen können.
- Der Vorschlag muss nun vom Europäischen Parlament und vom Rat angenommen werden. Um den betroffenen Unternehmen ausreichend Zeit zur Umstellung zu gewähren, ist eine Übergangsfrist von 24 Monaten ab Annahme des Vorschlags vorgesehen.
Praxistipp: Die vorgeschlagene Änderung betrifft zunächst die Vereinheitlichung der Ladebuchsen an den betroffenen elektronischen Geräten. Die für das Vorhaben der Gewährleistung eines einheitlichen Ladegeräts ebenfalls erforderliche Interoperabilität des externen Netzteils soll hingegen Gegenstand einer Überprüfung der Ökodesign-Verordnung sein, die ebenfalls noch in diesem Jahr eingeleitet werden soll. Betroffene Unternehmen sollten die Verfahren beobachten, um erforderlichenfalls rechtzeitig auf Änderungen der rechtlichen Anforderungen reagieren zu können.