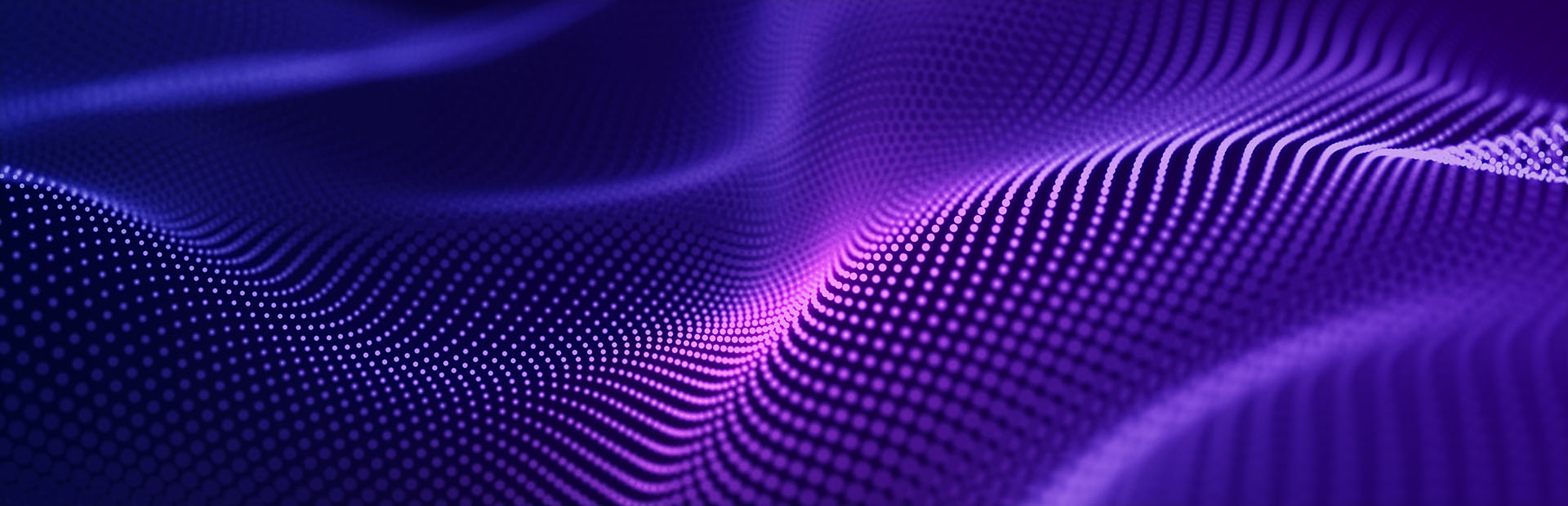Update Commercial 02/2025

Autoren
Februar 2025
In dieser Ausgabe unseres Updates informieren wir Sie unter anderem über zwei aktuelle Entscheidungen des EuGH zu Zahlungsfristen in AGB und möglichen Produkthaftungsrisiken auch für Händler.
Mit den Themen Produktsicherheit und Product Compliance befassen sich auch zwei neue Verordnungen: Der im Dezember 2024 in Kraft getretene Cyber Resilience Act schreibt ab Ende 2027 für Produkte mit digitalen Elementen erstmals EU-weit verbindliche Cybersicherheitsanforderungen vor. Ebenfalls ab Dezember 2027 gilt die Verordnung zum Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten, die es den zuständigen Behörden ab diesem Zeitpunkt ermöglichen wird, Produkte in der EU vom Markt zu nehmen, wenn sie unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden.
Aktuelle Rechtsprechung
(EuGH, Urteil v. 19. Dezember 2024 – C-157/23)
- Die europäische Produkthaftungsrichtlinie schreibt vor, dass für Schäden, die durch fehlerhafte Produkte entstehen, neben dem tatsächlichen Hersteller des Produkts auch diejenigen Personen oder Unternehmen haften, die ihren Namen oder andere Erkennungszeichen auf dem Produkt anbringen und so den Anschein erwecken, sie seien am Produktionsprozess beteiligt gewesen. In einer aktuellen Entscheidung weitet der EuGH diese Haftung des sog. Quasi-Herstellers – über den Wortlaut der Produkthaftungsrichtlinie hinaus – auch auf Lieferanten aus, die mit dem Hersteller lediglich den Namen teilen.
- Hintergrund des Falls war ein in Italien geführter Rechtsstreit infolge eines Unfalls mit einem Fahrzeug der Marke Ford, das ein italienischer Verbraucher im Jahr 2021 von einer italienischen Vertragshändlerin der Marke erworben hatte. Herstellerin des Fahrzeugs war die in Deutschland ansässige Ford-Werke AG, anschließend war das Fahrzeug über eine italienische Ford-Vertriebsgesellschaft (Ford Italia) an die italienische Vertragshändlerin geliefert worden. Nach dem Unfall, bei dem ein Airbag des Fahrzeugs nicht funktionierte, verklagte der Verbraucher die Vertragshändlerin und Ford Italia vor den italienischen Gerichten auf Schadenersatz.
- Ford Italia argumentierte vor Gericht, dass sie nicht Herstellerin des Fahrzeugs sei, sondern dieses nur geliefert habe. Der italienische Kassationsgerichtshof legte dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor, ob nach der Produkthaftungsrichtlinie eine Haftung eines Lieferanten als Quasi-Hersteller auch dann denkbar sei, wenn dieser zwar nicht seinen Namen oder ein Erkennungszeichen physisch auf dem Produkt angebracht habe, aber einen Namen, ein Warenzeichen oder ein anderes Erkennungszeichen habe, der bzw. das mit dem Namen oder einem Erkennungszeichen des Herstellers ganz oder teilweise übereinstimmt.
- Der EuGH bejahte diese Frage und begründet dies damit, dass der Verbraucherschutz ein weites Verständnis des Begriffs des „Herstellers“ erfordere. Dies solle die Last für durch fehlerhafte Produkte geschädigte Verbraucherinnen und Verbraucher lindern, den tatsächlichen Hersteller ermitteln zu müssen. In Anbetracht dieses Ziels der Richtlinie könne die Regelung über die Haftung des Quasi-Herstellers – entgegen ihrem ausdrücklichen Wortlaut, der eine aktive Handlung des „Anbringens“ voraussetzt – nicht nur Personen erfassen, die physisch ihren Namen, ihr Warenzeichen oder ein anderes Erkennungszeichen auf dem Produkt angebracht haben.
- Aus Sicht des EuGH bezieht sich die Vorschrift im Wesentlichen auf ein Verhalten einer Person, das den Eindruck erweckt, dass sie am Herstellungsprozess beteiligt oder dafür verantwortlich sei. Von einem solchen „Ausgeben als Hersteller“ sei insbesondere auszugehen, wenn der Name oder ein Erkennungszeichen dieses Lieferanten zum einen mit dem Namen des Herstellers und zum anderen mit dem vom Hersteller auf dem Produkt angebrachten Namen oder Erkennungszeichen übereinstimmt. Denn in diesen Fällen nutze der Lieferant ebenso die Übereinstimmung zwischen der in Rede stehenden Angabe und seiner eigenen Firmenbezeichnung, um sich den Verbraucherinnen und Verbrauchern als für die Qualität des Produkts Verantwortlicher zu präsentieren und bei ihnen ein vergleichbares Vertrauen hervorzurufen wie bei einem Erwerb unmittelbar vom Hersteller selbst.
Praxistipp: Der EuGH entwickelt mit der Entscheidung seine verbraucherfreundliche Rechtsprechung zur Haftung des Quasi-Herstellers weiter (siehe zuletzt z.B. Update Commercial 12/2022) und erhöht dadurch das Risiko für Händler, neben den Herstellern verschuldensunabhängig für Produktfehler in Anspruch genommen zu werden. Dies gilt vor allem für Konzerngesellschaften, deren Firmenbezeichnung sich mit der des Herstellers deckt. Die Begründung des EuGH lässt allerdings den Schluss darauf zu, dass auch eine Haftung von konzernfremden Händlern, die die Marke oder Kennzeichen des Herstellers in der Außendarstellung nutzen, mit entsprechenden Argumenten bejaht werden könnte. Dieses Risiko dürfte auch künftig unter der von den Mitgliedstaaten bis zum 9. Dezember 2026 umzusetzenden neuen Produkthaftungsrichtlinie (siehe Update Commercial 12/2024) weiter bestehen, da die Regelung zur Haftung des Quasi-Herstellers dort im Wesentlichen inhaltsgleich übernommen wurde. Es empfiehlt sich daher, diesen Risiken bereits vorab durch vertragliche Vereinbarungen zu begegnen. Zu denken ist hier beispielsweise an Informations- und Kooperationsverpflichtungen der Lieferanten im Falle ihrer Inanspruchnahme oder die Regelung von Rückgriffsmöglichkeiten gegenüber dem Hersteller.
Näheres zu der Entscheidung erfahren Sie auch in unserem Blog in dem Beitrag EuGH verschärft Herstellerbegriff im Rahmen der Produkthaftung.
(EuGH, Urteil v. 6. Februar 2025 – C‑677/22)
- Nach der europäischen Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr dürfen Zahlungsfristen in B2B-Verträgen 60 Kalendertage nicht überschreiten, sofern nicht im Vertrag ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde und diese Vereinbarung für den Gläubiger nicht grob nachteilig ist. In Deutschland wurde diese Vorgabe durch § 271a BGB umgesetzt, der vorsieht, dass eine entsprechende Regelung „ausdrücklich getroffen“ werden muss und „im Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig“ sein darf.
- Während jedenfalls in Deutschland seit Einführung dieser Vorgaben überwiegend davon ausgegangen wurde, dass eine solche „ausdrückliche Vereinbarung“ auch in AGB möglich ist, gab es hierzu bislang keine höchstrichterliche Entscheidung. Erst über zehn Jahre nach Erlass der Regelungen hat sich nun der EuGH auf eine polnische Vorlagefrage zur Auslegung der europäischen Vorgaben hin erstmals mit der Frage befasst, ob eine 60 Tage übersteigende Zahlungsfrist auch in von einer Vertragspartei einseitig vorgegebenen AGB wirksam vereinbart werden kann.
- Der EuGH entschied in diesem Zusammenhang, dass die Wendung „im Vertrag wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart“ die Äußerung eines übereinstimmenden Willens der Vertragsparteien verlange, die über die bloße ausdrückliche Erwähnung einer solchen Frist in einer Vertragsklausel hinausgehe. Dies gelte unabhängig davon, ob es sich bei dem Vertrag, in dem diese Klausel enthalten ist, ganz oder teilweise um einen vorformulierten Standardvertrag oder einen ähnlichen Vertrag handele. Dem Erfordernis könne zum einen dadurch Genüge getan werden, dass eine solche Klausel von den Parteien individuell ausgehandelt wurde. Andererseits könne es u.a. im Rahmen eines vorformulierten Standardvertrags genügen, wenn eine der Parteien die betreffende Klausel in den Vertragsunterlagen hervorgehoben hat, um sie klar von den anderen Klauseln des Vertrags zu unterscheiden und damit ihren Ausnahmecharakter zum Ausdruck zu bringen. In beiden Fällen würde es der anderen Partei ermöglicht, der Klausel in voller Kenntnis der Sachlage zuzustimmen.
- Im Hinblick auf die weitere Voraussetzung, dass eine entsprechende Vertragsklausel auch nicht grob nachteilig für den Gläubiger sein darf, seien in einem zweiten Schritt alle Umstände des jeweiligen konkreten Falles zu prüfen, wie etwa grobe Abweichungen von der guten Handelspraxis, die gegen den Grundsatz des guten Glaubens und der Redlichkeit verstoßen; die Art der betreffenden Ware oder der Dienstleistung und insbesondere die Frage, ob der Schuldner einen objektiven Grund für die Abweichung von der in der Richtlinie genannte Regelobergrenze von 60 Tagen hat.
Praxistipp: Der EuGH stellt mit seiner Entscheidung zunächst klar, dass eine 60 Tage überschreitende Zahlungsfrist auch in AGB vereinbart werden kann. Dies wurde auch nach deutschem Recht bislang überwiegend bejaht. Zwar regelt § 308 Abs. Nr. 1 lit. a BGB, dass bereits Zahlungsfristen von mehr als 30 Tagen ab Empfang der Gegenleistung oder Zugang einer Rechnung (auch in AGB im B2B-Vehältnis) „im Zweifel“ als unangemessen lang anzusehen sind. Kann der Verwender jedoch besondere Gründe darlegen, aus denen sich die Angemessenheit eines längeren Zeitraums ergibt, kann dies grundsätzlich auch in AGB vereinbart werden. Bei Zahlungsfristen von über 60 Tagen verlangt der EuGH nun allerdings ausdrücklich eine besondere Hervorhebung der Klausel. Es empfiehlt sich daher, entsprechende Klauseln in Standardverträgen optisch herauszustellen (etwa durch Fettdruck, Großbuchstaben oder andere optische Absetzungen) oder sich die Regelungen von der anderen Vertragspartei gesondert gegenzeichnen oder anderweitig bestätigen zu lassen.
Ob diese Möglichkeit auch in Zukunft noch bestehen wird, ist allerdings ungewiss: Im Herbst 2023 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für eine neue Verordnung zur Bekämpfung von Zahlungsverzug vorgelegt, die die Zahlungsverzugs-Richtlinie ablösen soll (wir berichteten im Update Commercial 10/2023). Während der Kommissionsentwurf noch eine einheitliche maximale Zahlungsfrist von 30 Tagen vorsah, hat sich das EU-Parlament im weiteren Gesetzgebungsverfahren bereits dafür ausgesprochen, zumindest Zahlungsfristen von bis zu 60 Kalendertagen zu ermöglichen, wenn diese wiederum „ausdrücklich im Vertrag vereinbart“ werden. Nur beim Erwerb von Waren mit langsamem Warenumschlag oder von Saisonwaren soll die Zahlungsfrist auf bis zu 120 Kalendertage verlängert werden können. Wann und in welcher Form die neue Zahlungsverzugs-Verordnung tatsächlich verabschiedet wird, ist derzeit jedoch noch nicht absehbar.
(LG Düsseldorf, Urteil v. 16. Januar 2025 – 14d O 14/24)
Das LG Düsseldorf hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass der Verkauf von Kaffeeprodukten unter den Herstellungskosten nicht zwangsläufig eine unbillige Behinderung nach § 20 Abs. 3 S. 1 GWB darstellt. Das Urteil präzisiert die Grenzen zulässiger Preisstrategien im Lebensmitteleinzelhandel und für Hersteller von Eigenmarken.
Ein mittelständischer Anbieter von Kaffeeprodukten klagte gegen eine große Einzelhandelskette, die seit Ende 2023 Kaffeeprodukte ihrer Eigenmarke während mehrerer Aktionswochen zu Preisen anbot, die nach Ansicht der Klägerin unter den Herstellungskosten lagen. Die Klägerin sah darin eine Ausnutzung überlegener Marktmacht und eine unbillige Behinderung nach § 20 Abs. 3 S. 1 GWB, da das spezielle Verbot des Anbietens unter Einstandspreis nach § 20 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GWB wegen der konzerninternen Produktion nicht direkt anwendbar sei.
Die Beklagte argumentierte, dass ihre Preisaktionen Teil einer zulässigen Mischkalkulation seien, die der Kundengewinnung diene und keine Verdrängungsabsicht verfolge. Außerdem fehle es an einer überlegenen Marktmacht auf dem relevanten Markt für Kaffeeprodukte.
Das LG Düsseldorf wies die Klage ab und stellte fest, dass kein Verstoß gegen § 20 Abs. 3 S. 1 GWB vorliegt. Maßgeblich für die Entscheidung waren folgende Erwägungen:
- Keine unbillige Behinderung nach § 20 Abs. 3 S. 1 GWB:
Eine unbillige Behinderung liegt nur vor, wenn eine Verdrängungsabsicht besteht oder eine nachhaltige Beeinträchtigung der strukturellen Voraussetzungen für wirksamen Wettbewerb zu befürchten ist. Das bloße Angebot unter den Herstellungskosten reicht hierfür nicht aus.- Zulässigkeit von Mischkalkulationen und Preisaktionen:
Das Gericht erkannte an, dass es im Lebensmitteleinzelhandel gängige Praxis sei, durch Mischkalkulationen und Aktionsangebote Kunden zu gewinnen. Solche Preisstrategien seien kartellrechtlich zulässig, solange sie nicht auf eine gezielte Verdrängung von Wettbewerbern abzielen. Insbesondere sogenannte Eckpreisartikel wie Kaffee, Milch oder Butter werden häufig als Lockangebote verwendet, um die Verkaufsmenge insgesamt zu erhöhen und Kunden in die Märkte zu ziehen. - Keine nachhaltige Wettbewerbsbeeinträchtigung:
Es sei auch keine nachhaltige Wettbewerbsbeeinträchtigung zu erwarten, da die Angebote zeitlich begrenzt und nur auf einzelne Produkte beschränkt waren. Selbst wenn kein Mitbewerber dauerhaft mit den Preisen der Beklagten mithalten könnte, bliebe der wirksame Wettbewerb erhalten, da sich Konkurrenten durch Sortiment, Qualität oder Beratung differenzieren können.
- Zulässigkeit von Mischkalkulationen und Preisaktionen:
- Keine Analogie zu § 20 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GWB:
Da es sich um selbst hergestellte Produkte handelt, greift das Verbot des Anbietens unter Einstandspreis nicht. Das Gericht sah keinen Anlass, diese strengen Maßstäbe auf Herstellungskosten zu übertragen. Für eine analoge Anwendung fehle es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke wie auch an der Vergleichbarkeit der Interessenlagen. - Kein Unterlassungsanspruch nach UWG:
Ein Unterlassungsanspruch aus dem UWG liege ebenfalls nicht vor. Es wäre widersprüchlich und systemwidrig, eine unbillige Behinderung i.S.d. § 20 Abs. 3 S. 1 GWB zu verneinen, aber für das gleiche Verhalten jedoch eine unlautere geschäftliche Handlung in Form einer allgemeinen Marktbehinderung nach § 3 Abs. 1 UWG anzunehmen.
Praxistipp: Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel können jedenfalls dann sehr weitgehend Aktionsangebote und Mischkalkulationen nutzen, wenn sie die Waren selbst herstellen und nicht auf die gezielte Verdrängung von Wettbewerbern abzielen. Preisstrategien sollten nachvollziehbar und betriebswirtschaftlich begründbar sein. Besonders bei häufigen und erheblichen Preisnachlässen empfiehlt sich eine genaue Prüfung, um kartellrechtliche Risiken zu minimieren. Bei von dritten Herstellern bezogenen Waren, was die Regel sein dürfte, bleibt weiterhin Vorsicht geboten. Die besondere Regelung in § 20 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GWB verbietet das Anbieten von Lebensmittel unter Einstandspreis. In diesem Fall ist genau zu prüfen, ob das geplante Aktionsangebot dazu führen würde, dass der Aktionspreis unter dem Einstandspreis liegt.
Dieses Urteil liegt auf der allgemeinen Linie, dass Aktionspreise grundsätzlich wünschenswert und nur in krassen Fällen kartellrechtlich verboten sein sollen. Das ist auch der Grund für dafür, dass die Kartellbehörden Niedrigpreisstrategien selten aufgreifen. Etwas anderes gilt nur für Angebote unter Einstandspreis. Abzuwarten bleibt, wie das OLG dies sehen wird. Die Klägerin hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt.
Gesetzgebung und Trends
- Am 13. Dezember 2024 ist die Verordnung über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt (EU Forced Labour Regulation, EUFLR) in Kraft getreten. Die Verordnung verbietet ab dem 14. Dezember 2027 das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von in Zwangsarbeit hergestellten Waren auf dem Unionsmarkt sowie ihre Ausfuhr (wir berichteten im Update Commercial 10/2022 über den Verordnungsentwurf der EU-Kommission).
- Die EUFLR ist von Unternehmen jeder Größe zu beachten und gilt für Produkte aller Art. Anders als beispielsweise das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) oder die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD, siehe dazu zuletzt Update Commercial 04/2024), begründet die EUFLR selbst keine Sorgfalts- oder Berichtspflichten, sondern ermöglicht den zuständigen Behörden, Produkte, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden, vom Unionsmarkt zu nehmen.
- Stellen die Behörden einen begründeten Verdacht auf Zwangsarbeit bei der Produktion fest, sind sie zur Durchführung weiterer Untersuchungen verpflichtet. Bestätigt sich der Verdacht, verbietet die Behörde das Inverkehrbringen oder die Bereitstellung der Produkte auf dem Unionsmarkt oder ihre Ausfuhr und kann den Unternehmen aufgeben, bereits auf dem Markt befindliche Produkte vom Markt zu nehmen oder aus dem Verkehr zu ziehen (d.h. zu recyceln oder, wenn dies nicht möglich ist, unbrauchbar zu machen, wobei verderbliche Produkte vorrangig gemeinnützigen oder im öffentlichen Interesse liegenden Initiativen gespendet werden sollen). Die Beweislast dafür, dass das betreffende Produkt in Zwangsarbeit hergestellt wurde, hat die Behörde. Die Waren können wieder auf dem Unionsmarkt zugelassen werden, sobald das betroffene Unternehmen Zwangsarbeit aus seinen Lieferketten eliminiert hat. Wurden austauschbare Bestandteile eines Produkts in Zwangsarbeit hergestellt, kann das Produkt gegebenenfalls weiter vertrieben werden, wenn die betreffenden Bestandteile ersetzt wurden.
- Sanktionen für Verstöße gegen Entscheidungen der zuständigen Behörden müssen die Mitgliedstaaten festlegen. Dabei müssen sie Leitlinien der Kommission über die Berechnungsmethode und Grenzwerte von Bußgeldern beachten. Überdies legt die Verordnung fest, dass die Kommission u.a. jede Entscheidung über das Verbot eines Produkts veröffentlichen muss, was einer zusätzlichen faktischen Sanktion gleichkommen kann („naming and shaming“).
Praxistipp: Aufgrund der EUFLR gilt in der EU künftig eine ähnliche Rechtslage wie in den USA, wo die zuständigen Behörden aufgrund des Tariff Act, ggf. in Verbindung mit dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), schon heute ein Produkt an der Landesgrenze stoppen können, wenn der Verdacht besteht, dass das Produkt oder eine Komponente in Zwangsarbeit hergestellt wurde. Zur Vorbereitung auf die EUFLR empfiehlt es sich, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko von Zwangsarbeit in den eigenen Lieferketten erkennen und verhindern zu können. Unternehmen, die bereits ein Risikomanagementsystem nach dem LkSG eingerichtet haben, sollten es auch zur Vermeidung des Verkaufsverbots nach der EUFLR nutzen. Anders als nach dem LkSG gilt unter der EUFLR allerdings nicht der Grundsatz der Bemühenspflicht und es greifen keine Erleichterungen im Hinblick auf mittelbare Zulieferer. Die Behörden sollen bei ihren Ermittlungen aber einen risikobasierten Ansatz verfolgen, d.h. sich auf Wirtschaftsakteure an den Stellen der Wertschöpfungskette konzentrieren, wo Zwangsarbeit am wahrscheinlichsten ist und am wirksamsten unterbunden werden kann. Um die Unternehmen bei der Einhaltung der neuen Vorgaben zu unterstützen, wird die EU-Kommission eine öffentlich zugängliche Datenbank mit verlässlichen und regelmäßig aktualisierten Informationen über das Zwangsarbeitsrisiko in bestimmten geografischen Gebieten oder in Bezug auf bestimmte Produkte einrichten. Darüber hinaus soll die Kommission bis Mitte 2026 verschiedene Leitlinien erarbeiten, die die Unternehmen, Behörden und Mitgliedstaaten bei der Einhaltung der Verordnung unterstützen sollen.
- Am 10. Dezember 2024 ist der sog. Cyber Resilience Act in Kraft getreten (wir berichteten zuletzt im Update Commercial 12/2023 über das Gesetzgebungsverfahren). Die Verordnung legt erstmals unionsweit verbindliche, horizontal anwendbare Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen fest, die direkt oder indirekt mit einem anderen Gerät oder einem Netz verbunden sind. Sie betrifft nahezu alle Soft- und Hardwareprodukte, die in einer vernetzten Umgebung eingesetzt werden können, sowie deren Datenfernverarbeitungslösungen. Die produktbezogenen Anforderungen des Cyber Resilience Act gelten im Wesentlichen für ab dem 11. Dezember 2027 in den Verkehr gebrachte Produkte. Doch auch bereits zuvor in den Verkehr gebrachte Produkte können in den Anwendungsbereich fallen, wenn an diesen nach dem vorgenannten Zeitpunkt wesentliche Änderungen vorgenommen werden.
- Die Verordnung regelt Vorgaben für Konzeption, Entwicklung, Herstellung und das Inverkehrbringen von vernetzten Produkten mit digitalen Elementen und nimmt dabei neben den Herstellern auch Einführer und Händler in die Pflicht. Die Hersteller treffen die umfangreichsten Pflichten: Sie müssen künftig für alle erfassten Produkte eine cybersicherheitsbezogene Risikobewertung durchführen und sicherstellen, dass die Produkte, die in Anhang I des Cyber Resilience Act geregelten (Mindest-)Cybersicherheitsanforderungen erfüllen. Die Risikobewertung ist in die technische Dokumentation aufzunehmen und über den gesamten Lebenszyklus der Produkte aktuell zu halten. Die Einhaltung der Cybersicherheitsvorgaben ist in einem Konformitätsbewertungsverfahren nachzuweisen und durch die Anbringung der künftig verpflichtenden CE-Kennzeichnung zu dokumentieren.
- Daneben treffen die Hersteller auch cybersicherheitsbezogene Informations- und Instruktionspflichten. Zudem sind die Hersteller verpflichtet, für die voraussichtliche Nutzungsdauer des Produkts, i.d.R. aber mindestens für einen Zeitraum von fünf Jahren, erkannte Sicherheitslücken der Produkte zu schließen. Ab dem 11. September 2026 gilt darüber hinaus eine Meldepflicht im Fall von aktiv ausgenutzten Schwachstellen und schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen.
- Für Einführer und Händler greifen abgestufte Prüf- und Meldepflichten. Sofern diese jedoch die betroffenen Produkte unter eigenem Namen oder eigener Marke in Verkehr bringen oder diese wesentlich verändern, gelten auch für Einführer und Händler die vorstehend skizzierten Herstellerpflichten.
- Für den Fall von Verstößen gegen den Cyber Resilience Act sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Sanktionsvorschriften zu erlassen, die u.a. Geldbußen von bis zu EUR 15.000.000,00 oder 2,5 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres des betroffenen Unternehmens umfassen müssen.
Praxistipp: Der Cyber Resilience Act selbst beinhaltet zwar einen Katalog grundlegender Cybersicherheitsanforderungen, maßgeblich für die Produktentwicklung werden aber vielmehr die noch von den mandatierten Normungsorganisationen CEN, Cenelec und ETSI auszuarbeitenden 41 harmonisierten Normen sein. Herstellern von unter die Verordnung fallenden Produkten ist zu empfehlen, sich sowohl rechtzeitig mit den neuen produktbezogenen Anforderungen vertraut zu machen als auch geeignete interne Prozesse und Strukturen für ein effizientes Schwachstellenmanagement und die Meldung von Schwachstellen und Vorfällen zu etablieren. Dass das Thema Cybersicherheit von Produkten auch schon vor dem Geltungsbeginn des Cyber Resilience Act Ende 2027 nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte, zeigen neben den ab dem 1. August 2025 geltenden Cybersicherheitsvorgaben der Funkanlagenrichtlinie die bereits seit Ende 2024 geltende neue Produktsicherheitsverordnung und die kürzlich in Kraft getretene reformierte Produkthaftungsrichtlinie (siehe dazu jeweils Update Commercial 12/2024): Beide Regelwerke führen Cybersicherheitsaspekte allgemein als Untergruppe allgemeiner Sicherheitsanforderungen an Produkte auf.
Seit seinem Wiedereinzug in das Weiße Haus hat US-Präsident Donald Trump den Ankündigungen seiner geplanten Zolloffensive bereits erste Taten folgen lassen, weitere Zollerhöhungen sollen folgen. Was dies für deutsche Exporteure bedeutet, wie sie sich bestmöglich gegen die Strafzölle absichern können und was bei bestehenden Verträgen zu beachten ist, beleuchten wir in unserem Blog in dem Beitrag Protektionismus à la Trump – Strafzölle als „Force Majeure“?