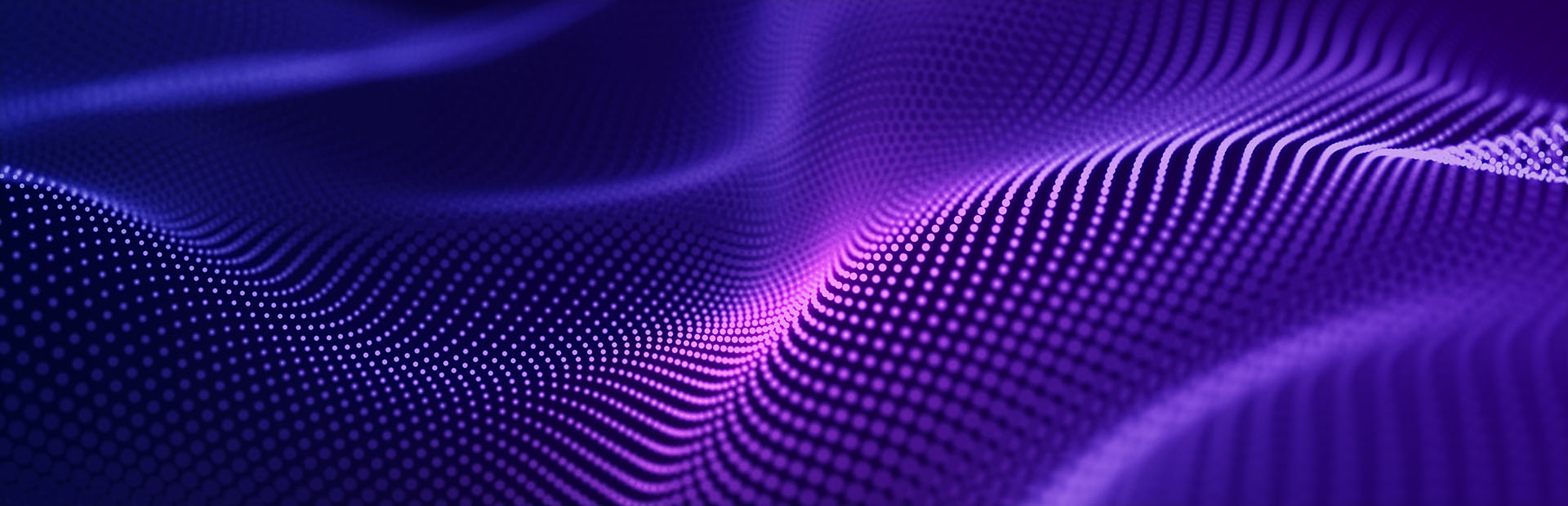Update Commercial 06/2021

Autoren
Am 16. Juli 2021 tritt die neue Marktüberwachungsverordnung in Kraft, eine der wichtigsten gesetzlichen Änderungen im Produktsicherheitsrecht in den letzten Jahren und voraussichtlich auch für die kommenden Jahre. In unserem kostenfreien einstündigen Online-Seminar am 2. Juli 2021 um 11.00 Uhr erläutert Dr. Ulrich Becker die neuen Regelungen der Verordnung, die die meisten non-food-Branchen betrifft. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.
Außerdem tauschen sich Dr. Heike Blank und Dr. Ulrich Becker in der neuesten Podcast-Folge über die Ergebnisse unserer aktuellen Know-How-Schutz-Studie aus und geben wichtige Tipps zum Geschäftsgeheimnisschutz. Hören Sie gerne rein.
Pünktlich vor Beginn der Urlaubszeit wollen wir Ihnen noch einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung geben. So hat der BGH jüngst zu Schadenspauschalen in AGB bei Kartellrechtsverstößen entschieden. Entsprechende Klauseln dürften sich somit in Zukunft häufiger in Einkaufsbedingungen finden. Zudem hat sich der BGH erneut mit der Wirksamkeit von Bestpreisklauseln auseinandergesetzt.
Im Bereich der Gesetzgebung ist natürlich vor allem das Lieferkettengesetz zu erwähnen, das wir kurz vorstellen. Hierzu ist auch auf das White Paper mit dem Titel „Managing Supply Chain Risk“ von BCG und CMS hinzuweisen, das Sie hier finden.
Zudem hat der Bundesgesetzgeber mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz erstmals grundlegende Anforderungen an die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen gestellt. Sie sind ab dem 28. Juni 2025 zu beachten.
Immer häufiger werden für Geschäftsmodelle – bewusst oder unbewusst – Abrechnungsservices genutzt, gerade auch auf Handelsplattformen. Daher geben wir einen Überblick darüber, welche aufsichtsrechtlichen Fallstricke zu beachten sind.
Inhalt
Im Folgenden finden Sie die Themen des Newsletters.
Aktuelle Rechtsprechung
- Unionsrechtskonformität der ergänzenden Vertragsauslegung bei unwirksamen AGB-Klauseln
- Zum pauschalierten Kartellschadensersatz in AGB
- BGH: Nutzungsentgelt für bargeldlose Zahlungen mittels „PayPal“ und „Sofortüberweisung“ zulässig
- Enge Bestpreisklausel von Booking.com unzulässig
- Ausschluss des Handelsvertreterausgleichs bei Beendigung aus wichtigem Grund
- Logistikpauschale ist als Bestandteil des Endpreises auszuweisen
- Zur hohen Bedeutung der Distributionsrate bei der sortimentsbedingten Abhängigkeit im Sinne des § 20 GWB
- Kein Anspruch aus Versicherung wegen coronabedingter Betriebsschließung
- LG Koblenz erklärt proaktive „Bewertungsschutzklausel“ für unwirksam
Gesetzgebung und Trends
- Lieferkettengesetz verabschiedet
- Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vom Bundestag beschlossen
- Zahlungsplattformen, Abrechnungsmodelle und das Finanztransfergeschäft
Bei Interesse können Sie das Update Commercial hier abonnieren.
Aktuelle Rechtsprechung
Unionsrechtskonformität der ergänzenden Vertragsauslegung bei unwirksamen AGB-Klauseln
(EuGH, Urteil v. 25. November 2020 – Rs. C-269/19)
- Der EuGH setzte sich in diesem Verfahren mit der Lückenfüllung im Fall einer unwirksamen AGB-Klausel bei gleichzeitigem Fehlen einer dispositivgesetzlichen Regelung auseinander.
- Das vorlegende Gericht hatte sich mit einem Darlehensvertrag zu befassen, der ab dem zweiten Jahr einen variablen Zinssatz vorsah, den die Bank ohne Zustimmung des Darlehensnehmers ändern konnte. Bereits die Vorinstanz hatte entschieden, dass die entsprechenden Klauseln des Darlehensvertrages unwirksam sind. Die durch die Unwirksamkeit entstandene Lücke konnte mangels dispositiven Rechts nicht gefüllt werden. Da sich das vorlegende Gericht mit diversen verschiedenen und in der rumänischen Rechtsprechung auch in dieser Vielfalt angewendeten Optionen konfrontiert sah, entschied es, den EuGH anzurufen und mehrere Vorlagefragen zur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen zu stellen. Zusammengefasst fragte das vorlegende Gericht, ob bei Missbräuchlichkeit einer solchen Zinsklausel und dem daraus folgenden Wegfall des ganzen Darlehensvertrages das nationale Gericht berechtigt sei, eine neue Methode zur Berechnung des Zinssatzes festzulegen oder die Parteien aufzufordern, über die Berechnung des Zinssatzes zu verhandeln.
- Der EuGH stellte zunächst klar, dass ein Bedürfnis dafür besteht, dass ein Vertrag als Ganzes trotz der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen aufrechterhalten wird. Dieses Bedürfnis besteht insbesondere dann, wenn die Unwirksamkeit einer Klausel die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge hätte und der Verbraucher den noch offenen Darlehensbetrag, den er sonst über einen längeren Zeitraum zurückgezahlt hätte, sofort zurückzahlen müsste.
- Der EuGH hält zunächst seine Rechtsprechung aufrecht, dass eine geltungserhaltende Reduktion, bei der das nationale Gericht den Vertrag durch Abänderung der Klausel lediglich an ein zulässiges Maß anpassen würde, unzulässig ist. Der Abschreckungseffekt gebietet es, dass die Klausel nicht nur auf das gerade noch zulässige Maß reduziert wird, sondern insgesamt wegfällt.
- Wenn der Vertrag bei Wegfall der unwirksamen Klausel nicht aufrechterhalten werden kann, zur Schließung der Lücke keine dispositiven Vorschriften des nationalen Rechts verfügbar sind und die Nichtigkeit des Vertrages für den Verbraucher besonders nachteilige Folgen hätte, soll das nationale Gericht alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Verbraucher vor den besonders nachteiligen Folgen zu schützen.
- Stimmt der Verbraucher der Aufrechterhaltung der missbräuchlichen Klauseln nicht zu, spricht nach Meinung des EuGH nichts dagegen, die Parteien zu Verhandlungen über die Lückenschließung aufzufordern. Den Rahmen dieser Verhandlungen muss allerdings das Gericht vorgeben, um das Gleichgewicht der Verhandlungsparteien zu sichern.
- Im deutschen Recht sind vom Gericht vorgegebene Verhandlungen zwischen den Parteien eines Vertrages nicht vorgesehen. Stattdessen ist eine solche Vertragslücke im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung (§ 157 BGB) zu schließen. Dabei kommt es allein darauf an, „was redliche und verständige Parteien bei Kenntnis der planwidrigen Regelungslücke nach dem Vertragszweck und sachgemäßer Abwägung ihrer beiderseitigen Interessen nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) vereinbart hätten“ (vgl. BGH, Urteil v. 11. Oktober 2005 – XI ZR 395/04 – Rn. 26). Dazu wird der in den bestehenden Vertragsklauseln zum Ausdruck kommende Parteiwille ermittelt und mit dem Sinn und Zweck des Vertrages sowie den beiderseitigen Interessen abgewogen. Wichtig ist aber, dass es dabei nicht darauf ankommt, was die konkreten Parteien tatsächlich vereinbart hätten. Maßgebend ist allein eine objektive Perspektive verständiger Parteien.
- Vorrangig zur ergänzenden Vertragsauslegung ist aber auch im deutschen Recht auf das dispositive Gesetzesrecht zurückzugreifen (§ 306 II BGB). Zudem muss die durch die Unwirksamkeit der Klausel entstandene Lücke zu einem Ergebnis führen, „das den beiderseitigen Interessen nicht mehr in vertretbarer Weise Rechnung trägt, sondern das Vertragsgefüge völlig einseitig zu Gunsten des Kunden verschiebt“ (BGH, Urteil v. 13. November 1997 – IX ZR 289/96 – Rn. 11).
- Unklar bleibt, ob es nach der Entscheidung des EuGH als zwingende Voraussetzung für die Lückenschließung erforderlich ist, dass der Vertrag nicht aufrechterhalten werden kann, diesem also durch den Wegfall der unwirksamen Klausel praktisch der Boden entzogen wird. Dies ist bei einer Zinsklausel in einem Darlehensvertrag der Fall. Indes dürfte eine ergänzende Vertragsauslegung zumindest nach deutschem Recht künftig nicht den Wegfall des Vertrages bedeuten, sondern nur voraussetzen, dass der Vertrag ohne die betreffende Klausel für eine Partei unbillig wäre.
Zum pauschalierten Kartellschadensersatz in AGB
(BGH, Urteil v. 10. Februar 2021 – KZR 63/18 und BGH, Urteil v. 10. Februar 2021 – KZR 94/18)
AGB-Klauseln, die dem Kunden eines Kartellbeteiligten einen pauschalen Schadensersatz zusprechen, sind nach der jüngsten Rechtsprechung des BGH grundsätzlich wirksam. Der Höhe nach hat der BGH sowohl eine Schadenspauschalierung von 5 % (KZR 63/18) als auch von 15 % (KZR 94/18) nicht beanstandet.
- Eine Klausel, nach der ein Auftragnehmer, wenn er „aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung … darstellt“, einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes der Abrechnungssumme zu zahlen hat, widerspricht nicht dem AGB-Recht, sofern sie dem Schädiger die Möglichkeit gibt, einen geringeren oder fehlenden Schaden nachzuweisen.
- Eine solche Klausel erfasst Submissionsabsprachen und ähnliche (horizontale) wettbewerbsbeschränkende Absprachen wie Preis-, Quoten-, Kundenschutz- oder Gebietsabsprachen, die darauf gerichtet und dazu geeignet sind, den im Rahmen der wettbewerblichen Auftragsvergabe vorausgesetzten Preisbildungsmechanismus zu stören.
- Der Anwendungsbereich einer solchen Klausel ist nicht auf Absprachen beschränkt, die sich unmittelbar auf die konkrete Auftragsvergabe beziehen, sondern umfasst auch generelle Absprachen zwischen Wettbewerbern, die aus Anlass zukünftiger Auftragsvergaben getroffen werden.
- Eine solche Klausel stellt keine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners dar, sofern sie den zu erwartenden Schaden in einer Höhe pauschaliert, die in der Bandbreite des nach dem typischerweise zu erwartenden hypothetischen Marktpreises verbleibt. Das ist bei einer Schadenspauschale von 5 %, aber auch bei einer solchen von 15 % zu bejahen.
- An den dem Schädiger obliegenden Nachweis eines für ihn günstigeren, weil zu einem geringeren oder keinem Schaden führenden hypothetischen Marktpreises sind die Anforderungen zu stellen, die umgekehrt für die Darlegung und den Beweis des hypothetischen Marktpreises durch den Geschädigten gelten. Gelingt dem Schädiger dieser Nachweis nicht, muss er sich an dem pauschalierten Betrag festhalten lassen.
Praxistipp: Die vorstehenden – im Wesentlichen vom BGH selbst aufgestellten – Leitsätze könnten den Eindruck vermitteln, dass die Entscheidungen ganz auf die öffentliche Auftragsvergabe zugeschnitten seien. Tatsächlich lassen sich die Ausführungen des BGH aber durchaus so verstehen, dass sie für Liefer- und sonstige Vertragsbeziehungen im geschäftlichen Wirtschaftsverkehr schlichthin Geltung beanspruchen. Für die Käuferseite ist damit der Praxistipp vorgezeichnet: Sie sollten darauf hinwirken, in ihren Einkaufsverträgen pauschalierte Kartell-Schadensersatzklauseln aufzunehmen und dabei zweckmäßigerweise möglichst eng dem Wortlaut der Klauseln folgen, wie sie vorliegend in Rede standen. Im Fall der Fälle sind solche Unternehmen von der Last befreit, ihre Kartellschäden in Zivilprozessen zeit- und kostenaufwendig und insbesondere mit Hilfe von ökonomischen Gutachten zu beziffern, und mehr als 15 % der Abrechnungssumme sind in aller Regel ohnehin nicht bei einem solchen individuellen Nachweis erzielbar.
Schwerer fällt der Ratschlag für die Verkäuferseite. Natürlich ist es erstes Ziel, Kartell-Schadensersatzklauseln nicht zu akzeptieren. Allerdings wird es nicht ganz einfach sein, dem Kunden zu erklären, warum man sich auf eine solche Klausel nicht einlassen will. Letztlich wird es eine Frage der Verhandlungsmacht (und -kultur) sein, ob ein Unternehmen die Abwehr solcher Klauseln durchsetzen kann (und will).
BGH: Nutzungsentgelt für bargeldlose Zahlungen mittels „PayPal“ und „Sofortüberweisung“ zulässig
(BGH, Urteil v. 25. März 2021 – I ZR 203/19)
- Der 1. Zivilsenat des BGH setzte sich in dem Verfahren mit der Frage auseinander, ob die Erhebung eines Zahlungsentgelts für die Nutzung der Zahlungsmittel „Sofortüberweisung“ und „PayPal“ (auch) gegen § 270 a BGB verstößt. In Umsetzung der Zweiten europäischen Zahlungsdiensterichtlinie existiert seit Anfang 2018 die Regelung des § 270 a BGB, wonach es verboten ist, für bestimmte bargeldlose Zahlungsmittel ein zusätzliches Entgelt zu erheben. Die Verbotsregelung nennt ausdrücklich die Zahlungsmittel SEPA-Basislastschriften, SEPA-Firmenlastschriften, SEPA-Überweisungen und Zahlungskarten. Bislang war jedoch umstritten und nicht höchstrichterlich geklärt, ob auch weitere Zahlungsmittel, insbesondere Zahlungen per PayPal und Sofortüberweisung, von dieser Vorschrift erfasst werden. Im Wortlaut des § 270 a BGB werden diese Zahlungsmittel nicht genannt.
- Der BGH hat nun entschieden, dass eine Vereinbarung, die den Schuldner bei der Wahl der Zahlungsmittel „Sofortüberweisung“ oder „PayPal“ zur Zahlung eines Entgelts verpflichtet, dann nicht gegen § 270 a BGB verstößt, wenn das Entgelt allein für die Nutzung dieser Zahlungsmittel und nicht für eine damit in Zusammenhang stehende Nutzung einer Lastschrift, Überweisung oder Zahlungskarte im Sinne von § 270 a BGB vereinbart wird.
- Laut dem BGH kommt es bei der Wahl einer Zahlung per „Sofortüberweisung“ zwar zu einer Überweisung vom Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Diese stelle auch eine SEPA-Überweisung im Sinne von § 270 a Satz 1 BGB dar. Es sei somit unerheblich, dass diese Überweisung nicht durch den Kunden, sondern im Auftrag des Kunden durch den Betreiber des Zahlungsdienstes „Sofortüberweisung“ ausgelöst wird. Das damit verbundene geforderte Entgelt wird nach Auffassung des BGH aber nicht für die Nutzung dieser Überweisung verlangt, sondern für die Einschaltung des Zahlungsauslösedienstes, der neben der Zahlungsauslösung weitere Dienstleistungen erbringt. Er überprüfe etwa die Bonität des Zahlers und unterrichtet den Zahlungsempfänger vom Ergebnis dieser Überprüfung. Dadurch könne der Zahlungsempfänger seine Leistung dann bereits vor Zahlungseingang erbringen.
- Wenn das PayPal-Konto des Zahlers kein ausreichendes Guthaben aufweist und durch eine Überweisung, Lastschrift oder Kreditkartenabbuchung aufgeladen werden muss, kann es laut dem BGH auch bei Verwendung der Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ zu einer SEPA-Überweisung oder einer SEPA-Lastschrift im Sinne von § 270 a Satz 1 BGB oder einem kartengebundenen Zahlungsvorgang im Sinne von § 270 a Satz 2 BGB kommen. Aber auch in dieser Konstellation werde das Nutzungsentgelt von den Kunden nicht für die Nutzung dieser Zahlungsmittel, sondern allein für die Einschaltung des Zahlungsdienstleisters „PayPal“ verlangt. Dieser wickle die Zahlung vom PayPal-Konto des Zahlers auf das PayPal-Konto des Empfängers durch Übertragung von E-Geld ab.
Praxistipp: Die Entscheidung des BGH ist in der Sache nicht gänzlich unumstritten, sie sorgt jedoch jedenfalls für die seit 2018 nötige Rechtssicherheit. Grundsätzlich besteht nun die Möglichkeit, Gebühren, die Unternehmen an die Zahlungsdienstleister abzuführen haben, ihren Kunden weiterhin zu berechnen. Es bleibt noch abzuwarten, ob Kunden im Anschluss an das Urteil des BGH künftig stets mit Gebühren rechnen müssen, wenn sie ein Zahlungsmittel unter Einbindung eines Zahlungsdienstanbieters wählen. PayPal hat beispielsweise (bereits seit dem erstinstanzlichen noch gegenläufigen Urteil) eine Regelung aufgenommen, wonach Unternehmen für PayPal-Zahlungen keine Zusatzgebühren gegenüber Kunden verlangen dürfen. Insofern sind Unternehmen ggf. anstelle des (etwaigen) aus § 270 a BGB folgenden gesetzlichen Verbots aufgrund eines vertraglichen Verbots gegenüber dem jeweiligen Zahlungsdienstleister gebunden.
Enge Bestpreisklausel von Booking.com unzulässig
(BGH, Beschluss v. 18. Mai 2021 – KVR 54/20)
- Bereits im Jahr 2015 hatte das OLG Düsseldorf sog. weite Bestpreisklauseln von Hotelbuchungsportalen für unzulässig erklärt. Diese Klauseln untersagten den Hotels, sowohl (i) auf anderen Hotelportalen als auch (ii) auf der eigenen Hotel-Website und (iii) an der Rezeption selbst Zimmer zu günstigeren Konditionen anzubieten als auf der betreffenden Buchungsplattform.
- In der Folge änderten die Portalseitenbetreiber ihre Klauselwerke hin zu einer sog. engen Bestpreisklausel: Booking.com erlaubte den Hotels, ihre Zimmer auf anderen Hotelportalen und über andere Vertriebskanäle (z. B. am Hoteltresen) preiswerter anzubieten. Auf der hoteleigenen Website durften die Preise für die Zimmer jedoch weiter nicht niedriger sein als bei Booking.com.
- Booking.com hatte vor dem BGH erfolglos argumentiert, dass die Klausel erforderlich sei, um der sog. Trittbrettfahrerproblematik entgegenzuwirken: Gäste buchen nämlich häufig direkt auf der hoteleigenen Website, nachdem sie sich zuvor bei Booking.com umfangreich informiert haben. Hierfür erhält
Booking.com dann keine Provision von den Hoteliers. - Die Argumentation überzeugte den BGH jedoch nicht. Insbesondere hätten Ermittlungen des Bundeskartellamtes ergeben, dass Booking.com seine Marktstellung auch nach Untersagung der Klausel durch das Bundeskartellamt weiter ausbauen konnte.
- Das Urteil des BGH dürfte auf andere Plattformbetreiber übertragbar sein, sofern sie – wie Booking.com – einen Marktanteil von über 30 % erreichen. Unterhalb dieser Schwelle hatte das OLG Düsseldorf bereits im Jahr 2017 in einem Verfahren zur Hotelbuchungsplattform Expedia festgehalten, dass sowohl weite als auch enge Bestpreisklauseln der Vertikal-GVO unterfallen und keine Kernbeschränkung darstellen. Wenn also Portalbetreiber unterhalb der 30%-Marktanteilsschwelle liegen, dürften weite und enge Bestpreisklauseln weiter zulässig sein.
Praxistipp: Booking.com hatte die entsprechende Klausel bereits seit dem Jahr 2016 nicht mehr verwendet. Das Urteil dürfte aber auch auf andere Plattformen im Internet übertragbar sein, sofern diese eine Marktstellung von über 30 % aufweisen.
Portalbetreiber sollten sich fragen, ob sie in diese Kategorie fallen, und die Verträge ggf. auf Bestpreisklauseln hin überprüfen. Umgekehrt gilt für die Anbieter auf solchen Plattformen, dass auch sie prüfen sollten, ob ggf. unwirksame Bestpreisklauseln enthalten sind. Dabei müssen beide Seiten im Hinterkopf behalten, dass die Frage der Zulässigkeit von Bestpreisklauseln EU-weit nicht immer einheitlich gehandhabt wird. In Frankreich oder Belgien sind z. B. bestimmte Bestpreisklauseln per Gesetz verboten. In Schweden andererseits hatte ein Gericht eine enge Bestpreisklausel für zulässig gehalten.
Ausschluss des Handelsvertreterausgleichs bei Beendigung aus wichtigem Grund
(KG Berlin, Beschluss v. 22. Februar 2021 – 2 U 13/18)
- Das Kammergericht setzte sich in diesem Verfahren mit dem Ausschluss des Handelsvertreterausgleichs wegen einer Kündigung auseinander, die durch einen wichtigen Grund motiviert war.
- Der Handelsvertreter hatte dem Unternehmer verschwiegen, dass seine Ehefrau beabsichtigte, die Handelsvertretung für den Hauptkonkurrenten des Unternehmers zu übernehmen. Die Ehefrau lebte mit dem Handelsvertreter zusammen. In der Ehewohnung befand sich auch das Büro des Handelsvertreters. Etwa zweieinhalb Monate, nachdem der Unternehmer davon Kenntnis erhalten hatte, kündigte er den Handelsvertretervertrag fristlos. Der Handelsvertreter kündigte seinerseits zwei Wochen später fristlos mit der Begründung, die Kündigung des Unternehmers sei unbegründet.
- § 89 b Abs. 3 Nr. 2 HGB sieht vor, dass der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters ausgeschlossen ist, wenn „der Unternehmer das Vertragsverhältnis gekündigt hat und für die Kündigung ein wichtiger Grund wegen schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters vorlag“. In dem vom KG behandelten Fall stellte sich die Frage, ob dieser Tatbestand nur dann erfüllt ist, wenn die Kündigung zugleich die Voraussetzungen einer außerordentlichen Kündigung erfüllt, durch die das Vertragsverhältnis nach § 89 a Abs. 1 Satz 1 HGB vorzeitig beendet werden kann.
- Das KG entnimmt § 89 b Abs. 3 Nr. 2 HGB drei Voraussetzungen: (1) Der Unternehmer muss den Handelsvertretervertrag gekündigt haben, (2) es muss ein wichtiger Grund in einem schuldhaften Verhalten des Handelsvertreters vorgelegen haben, (3) der wichtige Grund muss für die Kündigung kausal geworden sein. Obwohl der Begriff des wichtigen Grundes in § 89 b Abs. 3 Nr. 2 HGB mit dem in § 89 a Abs. 1 Satz 1 HGB übereinstimmt, erfordert also keine dieser Voraussetzungen, dass die Kündigung auch zur Beendigung des Vertrages geführt hat. Daher ließ das KG ausdrücklich offen, ob die fristlose Kündigung des Unternehmers zur Beendigung des Vertrages geführt hatte, was zumindest zweifelhaft sein konnte, weil die Rechtsprechung üblicherweise annimmt, dass bereits eine Überlegungsfrist von zwei Monaten vor Ausspruch der Kündigung der Annahme eines wichtigen Grundes entgegensteht. Ausreichend war, dass zwischen den Parteien unstreitig war, dass das Vertragsverhältnis jedenfalls beendet war.
- Über die Ausführungen des KG hinaus ist Folgendes zu beachten: Bei der Auslegung des § 89 b Abs. 3 Nr. 2 HGB muss berücksichtigt werden, dass dieser durch Art. 18 RL 86/653/EWG unionsrechtlich determiniert und daher eine richtlinienkonforme Auslegung geboten ist. Neben dem Erfordernis eines unmittelbaren Kausalzusammenhangs zwischen dem wichtigen Grund und der Beendigung („wegen“) fällt in Art. 18 RL auf, dass nicht – wie in § 89 b Abs. 3 Nr. 2 HGB der Fall – von einer Kündigung, sondern von einer Beendigung des Handelsvertretervertrages die Rede ist. Erforderlich ist daher lediglich, dass ein schuldhaftes Verhalten des Handelsvertreters, das einen wichtigen Grund darstellt, für eine irgendwie geartete Beendigung des Handelsvertretervertrages ursächlich geworden ist. Auch eine einvernehmliche Beendigung durch Aufhebungsvertrag genügt diesen Anforderungen. Der Wortlaut des § 89 b Abs. 3 Nr. 2 HGB verlangt hingegen, dass der Unternehmer eine Kündigung ausgesprochen hat.
- Diese lag in dem vom KG entschiedenen Fall vor, sodass die Abweichung des deutschen Rechts von der Richtlinie vom KG nicht thematisiert werden musste. Die Besonderheit bestand darin, dass der Unternehmer die außerordentliche Kündigung erst zweieinhalb Monate nach Kenntnisnahme von den ersten Anhaltspunkten für den wichtigen Grund ausgesprochen hatte. Dies konnte zu einer Überschreitung der angemessenen Überlegungsfrist und somit dazu führen, dass die fristlose Kündigung des Unternehmers nur als ordentliche Kündigung wirksam sein konnte. Darauf kam es aber nicht an, da der Handelsvertreter seinerseits das Vertragsverhältnis gekündigt hatte und somit zwischen den Parteien jedenfalls Einigkeit darüber bestand, dass das Vertragsverhältnis beendet worden war.
Praxistipp: Ein Ausschluss des Ausgleichsanspruchs nach § 89 b Abs. 3 Nr. 2 HGB setzt nicht voraus, dass zugleich eine (wirksame) außerordentliche Kündigung nach § 89 a Abs. 1 Satz 1 HGB ausgesprochen wurde. Das erweitert den Spielraum für eine Reaktion des Unternehmers auf ein vertragswidriges Verhalten des Handelsvertreters. Der Unternehmer muss nicht unbedingt innerhalb kürzester Zeit fristlos kündigen, um den Ausgleichsanspruch zu beseitigen. Eine Kündigung sollte aber angesichts des Wortlauts der deutschen Vorschrift vorsorglich ausgesprochen werden, eine Beendigung auf andere Weise (z. B. durch einvernehmliche Auflösung des Vertrages) ist zumindest riskant.
Logistikpauschale ist als Bestandteil des Endpreises auszuweisen
(OLG Bamberg, Urteil v. 3. März 2021 – 3 U 31/20)
- Diesem vom OLG Bamberg entschiedenen Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Beklagte betreibt einen Online-Shop, über den sie Büromaterialien an gewerbliche und private Kunden vertreibt. Bei Anklicken eines bestimmten Produkts auf der Website öffnet sich ein eigenes Fenster mit einer Abbildung des Produkts und Angaben zu dessen Netto- und Bruttopreis. Unter dieser Preisangabe befindet sich der Hinweis „zzgl. Versand“. Bei Anklicken dieses Links erscheint die Information, dass unterschieden wird zwischen einer „Frachtpauschale“ (EUR 2,95 netto) und einer „Logistikpauschale“ (EUR 1,95 netto). Bei Bestellungen bis EUR 49,00 netto fallen sowohl Logistik- als auch Frachtpauschale an, bei Bestellungen darüber entfällt allein die Frachtpauschale.
- Mit der Logistikpauschale legt die Beklagte interne Kosten für Verpackungsmaterialien und Personal beim Versendungsvorgang auf die Käufer um. Sie wird nicht gemäß dem einzelnen Bestellvorgang berechnet, sondern beruht auf einer jährlichen Kalkulation der Beklagten, nach der z. B. im Jahr 2018 pro Bestellung EUR 2,13 an Verpackungs- und Personalkosten angefallen waren. Hiervon legt die Beklagte EUR 1,95 über die Logistikpauschale auf jeden Käufer um.
- Die Wettbewerbszentrale nahm die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch: Sie rügte, dass 1. der Produktpreis nicht alle vom Käufer zu tragenden Preisbestandteile enthalte, da die Logistikpauschale nicht in den Gesamtpreis einberechnet worden sei (Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Preisangabenverordnung (PAngV)), und 2. der Verbraucher in die Irre geführt werde, weil er annehmen müsse, die Artikel zu dem angegebenen Bruttopreis erwerben zu können (Verstoß gegen § 4 Nr. 11 und § 5 Abs. 1 Nr. 2 UWG). Die Beklagte machte geltend, dass die Logistikpauschale nicht in den Endpreis einzurechnen sei, da es sich hierbei um „sonstige Kosten“ handele, die gemäß § 1 Abs. 2 PAngV gesondert ausgewiesen seien.
- Nachdem das LG Aschaffenburg die Klage abgewiesen hatte, hob das OLG Bamberg die erstinstanzliche Entscheidung auf und verurteilte die Beklagte antragsgemäß: Die Logistikpauschale sei in den Gesamtpreis des jeweiligen Produktes einzurechnen, da diese mit Material- und Personalkosten der Beklagten rein interne Kosten erfasse, die Teil des Geschäftsmodells der Beklagten seien und keinerlei Bezug zur einzelnen Bestellung aufwiesen. Unter die in § 1 Abs. 2 PAngV genannten „Fracht-, Liefer- oder Versandkosten oder sonstigen Kosten“, die nicht in den Gesamtpreis einzurechnen, aber gesondert auszuweisen sind, fiele die Logistikpauschale nicht. Denn § 1 Abs. 2 PAngV beschreibe Kosten, die außerhalb des Betriebs des Unternehmers anfallen und deren Höhe sich meist erst aufgrund des Umfangs der Bestellung ergebe. Außerdem rechne der Verbraucher damit, dass bei Online-Bestellungen zusätzlich Versandkosten anfallen. Dass aber die Beklagte mit dem Bruttopreis der Produkte werbe, obwohl unabhängig vom Warenwert immer zusätzlich eine Logistikpauschale (für interne Kosten) aufgeschlagen werde, führe den Verbraucher über den wahren Preis des Produkts in die Irre. Dieser unzutreffende Eindruck werde dadurch verstärkt, dass die Frachtkostenpauschale bei einem Bestellwert von über EUR 49,00 wegfalle. Der Verbraucher müsse annehmen, dass dann nur der Endpreis zu bezahlen sei. Zusätzlich fällt allerdings die Logistikpauschale an.
Praxistipp: Die Entscheidung des OLG Bamberg zeigt abermals, dass bei der Gestaltung von Online-Shops besonderes Augenmerk auf die Angabe der Produktpreise und eventueller zusätzlicher Kosten zu legen ist. Im Vorfeld sollte geprüft werden, welche Positionen in den Endpreis einzurechnen und welche gesondert auszuweisen sind.
Zur hohen Bedeutung der Distributionsrate bei der sortimentsbedingten Abhängigkeit im Sinne des § 20 GWB
(OLG Düsseldorf, Urteil v. 14. April 2021 – VI-U (Kart) 14/20)
- Das Urteil des OLG Düsseldorf fügt sich in die kartellrechtliche Judikatur zur sehr praxisrelevanten Fallgruppe der Lieferverweigerung ein und unterstreicht die Bedeutung der Distributionsrate, um eine sortimentsbedingte Spitzenstellungsabhängigkeit festzustellen. Diese Variante der vertikalen Marktstärke hat wiederum besondere Relevanz für die Normadressateneigenschaft nach § 20 GWB.
- Bei der Feststellung einer Spitzenstellungsabhängigkeit kommt regelmäßig der Distributionsrate eine maßgebliche Bedeutung zu.
- Sie ist bei einem nicht selektiv vertriebenen Produkt im Allgemeinen notwendige Voraussetzung für eine Spitzenstellung und zugleich deutliches Indiz für eine Spitzenstellungsabhängigkeit.
- Auch bei einer hohen Distributionsrate steht die Spitzenstellung des betreffenden Produktes aber noch nicht fest. Vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Wettbewerbsfähigkeit des Lieferung begehrenden Händlers nach dem konkreten Zuschnitt seines Geschäftsbetriebes tatsächlich davon abhängt, dass er mit einer bestimmten Marke beliefert wird.
Praxistipp: Belieferungsklagen von Händlern gegen Markenartikelhersteller sind in Deutschland seit der Erstreckung des Diskriminierungsverbots auf relativ marktstarke Unternehmen im Jahr 1973 gang und gäbe. Vorliegend hat nicht – wie normalerweise – ein Einzelhändler, sondern ein auf der Großhandelsebene tätiges Verbundunternehmen auf Belieferung mit Nike-Sportschuhen geklagt. Ungeachtet dieser Besonderheit kam es letztlich auch hier auf die Marktgegebenheiten auf der Einzelhandelsebene für Schuh- und Sportfachgeschäfte an.
Wie so oft erwies sich auch hier das in Anspruch genommene Unternehmen als nicht marktbeherrschend (mit einem eigenen Marktanteil von 29 % und Marktanteilen von Adidas / Reebok von 21 % und von Asics von 6 %). Da diese drei Unternehmen auch in einem lebhaften Produkt- und Preiswettbewerb stehen (laut OLG Düsseldorf gerichtsbekannt), war auch die Oligopol-Marktbeherrschungsvermutung widerlegt.
Es kam somit darauf an, ob eine Spitzenstellungsabhängigkeit vorlag, für die die Distributionsrate nach Einschätzung des OLG Düsseldorf aber zu niedrig war. Nach einer vom Bundeskartellamt durchgeführten Umfrage (durchgeführt zu einer Zeit, als die Beklagte noch kein selektives Vertriebssystem praktizierte) ergab sich eine Distributionsrate von 46 % für das Segment Laufschuhe und von 76 % für das Segment Sportschuhe. Beide Distributionsraten, auch die höhere, beurteilte das OLG Düsseldorf als zu niedrig (zumal sich die Distributionsrate des Konkurrenten Adidas auf 90 % belief). Die Entscheidung fügt sich ein in die anderer Gerichte, die Distributionsraten von 50 % bis 60 % (Instanzgerichte) und sogar von nahezu 80 % (BGH) als nicht hoch genug angesehen haben.
Berichtenswert ist noch, dass das OLG Düsseldorf dem Beweisangebot der Klägerin, namentlich benannte Händler als „sachverständige Zeugen“ zu vernehmen, nicht nachgegangen ist. Denn aussagen könnten die Zeugen nur zu ihrer subjektiven Einschätzung über die Bedeutung von Nike-Schuhen für den Markt, ohne objektive Angaben zu den Marktverhältnissen machen zu können.
Kein Anspruch aus Versicherung wegen coronabedingter Betriebsschließung
(OLG Oldenburg, Urteil v. 18. Mai 2021 – 1 U 10/21)
- Das OLG Oldenburg setzte sich in seiner Entscheidung mit den Bedingungen einer Betriebsschließungsversicherung und dem Umfang des Versicherungsschutzes auseinander. Einen Entschädigungsanspruch wegen einer coronabedingten Betriebsschließung lehnte es aufgrund der Versicherungsbedingungen in dem konkreten Fall ab.
- Die Bedingungen der Betriebsschließungsversicherung regelten, dass „die folgenden“ in den §§ 6, 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG) namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger einen Entschädigungsanspruch begründen. Daran schloss sich eine Auflistung verschiedener Krankheiten und Krankheitserreger an.
- Das OLG Oldenburg entschied, dass die Erkrankung COVID-19 und der Krankheitserreger SARS-CoV-2 nach objektiver Auslegung eindeutig nicht von dieser Regelung umfasst seien. Ein um Verständnis bemühter Versicherungsnehmer könne angesichts der Formulierung und unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Regelung in den Versicherungsbedingungen nicht annehmen, dass eine Betriebsschließung infolge von COVID-19 bzw. SARS-CoV-2 dem Versicherungsschutz unterfalle.
- Bereits aus dem für die Auslegung in erster Linie zu berücksichtigenden Wortlaut ergebe sich, dass nur „die folgenden“ und nicht etwa noch weitere Krankheiten und Krankheitserreger den Versicherungsfall begründen sollen.
- Dies lasse sich auch daraus schließen, dass die Auflistung in den Versicherungsbedingungen nicht deckungsgleich mit dem Katalog der §§ 6, 7 IfSG sei. Für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer sei aufgrund dieser Abweichung ohne weiteres erkennbar, dass der in den Versicherungsbedingungen enthaltenen Aufzählung abschließender Charakter zukomme. Im Übrigen sei dem um Verständnis bemühten Versicherungsnehmer auch zuzumuten, sich beim Abschluss einer Betriebsschließungsversicherung Kenntnis über die in den Versicherungsbedingungen genannten gesetzlichen Regelungen zu verschaffen.
- Es mache außerdem keinen Sinn, einzelne Krankheiten und Krankheitserreger aufzulisten, wenn für den Umfang des Versicherungsschutzes die gesetzlichen Regelungen des IfSG in ihrer jeweils gültigen Fassung maßgeblich seien.
- Zudem könne ein Versicherungsnehmer nicht erwarten, dass ein Versicherer ein für ihn nicht kalkulierbares Risiko übernehme. Er könne daher nicht annehmen, dass der Versicherer im Rahmen der Betriebsschließungsversicherung auch Kosten abdeckt, die sich aus zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht bekannten, möglicherweise nicht einmal existierenden Krankheiten ergeben – zumal angesichts der Verwendung einer Auflistung von Krankheiten und Krankheitserregern in den Versicherungsbedingungen. Dies gilt nach dem OLG Oldenburg auch dann, wenn die Symptome und Verläufe einer COVID-19-Erkrankung mit denen der in den Versicherungsbedingungen explizit genannten Krankheiten vergleichbar sind.
- Die Regelung in den Versicherungsbedingungen hält nach Ansicht des OLG Oldenburg auch der für die Wirksamkeit allgemeiner Geschäftsbedingungen maßgeblichen Inhaltskontrolle stand, da sie nicht von Rechtsvorschriften abweiche. Die Abweichung von der Aufzählung in §§ 6, 7 IfSG sei insofern unbeachtlich. Denn das IfSG enthalte keine Bestimmungen zur Ausgestaltung von Versicherungen, sondern diene allein dem Zweck, übertragbaren Krankheiten vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.
- Die Bestimmung sei auch klar und verständlich im Sinne des für allgemeine Geschäftsbedingungen geltenden Transparenzgebotes. Denn es werde nicht der Eindruck vermittelt, es käme auf die Regelungen des IfSG, insbesondere die Auflistung in den §§ 6, 7 IfSG, an. Ein Verstoß gegen das Transparenzgebot sei nicht bereits deshalb anzunehmen, weil die Regelung noch klarer und verständlicher hätte formuliert werden können.
Praxistipp: Die Entscheidung des OLG Oldenburg zeigt auf, welche Bedeutung den Bedingungen einer (Betriebsschließungs-)Versicherung und ihrer Auslegung zukommt. Sowohl Versicherer als auch Versicherungsnehmer sollten daher sehr genau auf die Formulierung der Versicherungsbedingungen achten.
LG Koblenz erklärt proaktive „Bewertungsschutzklausel“ für unwirksam
(LG Koblenz, Urteil v. 26. Januar 2021 – 3 HKO 19/20)
- Dem LG Koblenz lag eine in allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) enthaltene Regelung zur Entscheidung vor, mit der sich der Verwender der AGB, ein Coaching-Dienstleister, vor kritischen Bewertungen im Internet schützen wollte. Das LG Koblenz entschied, dass die Regelung AGB-rechtlich unwirksam ist.
- Der Coaching-Dienstleister hatte in den auf seiner Website abrufbaren AGB folgende Regelung platziert: „Bewertungen (Sterne, Kommentare) innerhalb sozialer Medien […] geben die Parteien nur im gegenseitigen Einvernehmen ab.“ Zusätzlich war dort geregelt: „Auf erstes Anfordern von uns entfernt der Kunde eine über uns abgegebene Bewertung dauerhaft. Dies gilt auch nach Beendigung des Vertrages zwischen uns und dem Kunden. Entfernt der Kunde auf erstes Anfordern die von uns beanstandete Bewertung /Kommentar nicht, gilt eine angemessene und von uns festzusetzende und im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe als verwirkt.“
- Das LG Koblenz sah darin eine Regelung, die geeignet ist, das Recht der Kunden zur Abgabe von Kundenbewertungen, die verfassungsrechtlich durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG geschützt ist, unzulässig einzuschränken. Sachlich gerechtfertigte Kritik an seinen Leistungen müsse ein Unternehmen grundsätzlich hinnehmen. Grenzen werden der Kritik erst dort gesetzt, wo diese als reine Schmähkritik bzw. falsche Tatsachenbehauptungen oder Formalbeleidigungen zu qualifizieren ist.
- Entsprechend hat das LG Koblenz in seiner Entscheidungsbegründung die Regelung nach § 307 Abs. 1 BGB für unwirksam erklärt, da sie Kunden unangemessen benachteiligt, indem sie deren grundrechtlich geschützte Freiheiten einschränkt. Auf die Privatautonomie könne sich der Coaching-Dienstleister nicht berufen, da diese jedenfalls dort ende, wo sie die Grenzen der Rechtsordnung überschreitet. Die maßgeblichen Grenzen bilden hier § 307 BGB bzw. die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften.
Praxistipp: Die Entscheidung des LG Koblenz überrascht nicht. AGB-Regelungen, die einzig und allein darauf abzielen, die Abgabe unliebsamer Bewertungen zu unterbinden bzw. zu kontrollieren, und damit das Recht der freien Meinungsäußerung der Vertragsparteien massiv einschränken, halten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand und können zusätzlich als wettbewerbswidrig angesehen werden, was wiederum die Gefahr einer Abmahnung erhöht. In der Praxis ist von der Verwendung derartiger „Bewertungsschutzklauseln“ daher abzuraten. Dies bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass Unternehmen sich gegen widerrechtliche negative Bewertungen nicht zur Wehr setzen können.
Gesetzgebung und Trends
Lieferkettengesetz verabschiedet
(Entwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten)
(Beschlussempfehlung und Bericht zu dem Gesetzentwurf)
Am 11. Juni 2021 hat der Bundestag das Lieferkettengesetz beschlossen. Zwei Wochen später passierte das Gesetz auch den Bundesrat. Die Ausfertigung durch den Bundespräsidenten und die Verkündung im Bundesgesetzblatt stehen noch aus. Was hat sich nach unserem Beitrag im Update Commercial April 2021 Neues ergeben?
- Das Gesetz heißt nun in offizieller Kurzbezeichnung „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“.
- Wie ursprünglich beabsichtigt wird das Gesetz am 1. Januar 2023 für deutsche Unternehmen mit mindestens 3.000 Arbeitnehmern in Kraft treten, und diese Schwelle wird ein Jahr später auf 1.000 Arbeitnehmer absinken. Neu ist insbesondere, dass auch ausländische Unternehmen das Gesetz beachten müssen, wenn sie eine Zweigniederlassung mit entsprechender Arbeitnehmeranzahl in Deutschland haben, und dass bei der Bestimmung der Arbeitnehmeranzahl in allen Fällen nur im Inland beschäftigte Arbeitnehmer zu berücksichtigen sind.
- Bei den umweltbezogenen Risiken sind nun neben Quecksilber und persistenten organischen Schadstoffen auch Abfälle einbezogen.
- Die zivilrechtliche Haftung für die Verletzung der neuen Sorgfaltspflichten ist – nach längeren Diskussionen zwischen den Koalitionsfraktionen – jetzt ausdrücklich ausgeschlossen. Insbesondere das Risiko einer Haftung nach ausländischem Recht bleibt aber bestehen.
- Die Europäische Kommission hat den angekündigten Gesetzentwurf über unternehmerische Sorgfaltspflichten bislang nicht vorgelegt. Damit ist aber noch in diesem Jahr zu rechnen.
Praxistipp: Unternehmen, für die das Lieferkettengesetz gilt, sollten sich nun zügig auf die neuen Anforderungen vorbereiten. Bis zum Inkrafttreten verbleiben anderthalb Jahre – das ist nicht viel Zeit, um das vom Gesetz verlangte Risikomanagement einzuführen. Alle anderen Unternehmen sollten sich darauf einstellen, dass Kunden von ihnen verlangen könnten, die Sorgfaltspflichten zu beachten. Überdies ist es ratsam, das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene im Blick zu behalten. Denn die geplante Richtlinie wird voraussichtlich mehr Unternehmen betreffen und strengere Vorgaben machen als das deutsche Lieferkettengesetz. Informationen über gesetzliche Regelungen in anderen Ländern und praktische Hinweise für das Risikomanagement enthält das vor wenigen Tagen von CMS in Kooperation mit der Boston Consulting Group (BCG) herausgegebene White Paper „Managing Supply Chain Risk“.
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vom Bundestag beschlossen
- Am 20. Mai 2021 hat der Bundestag das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen, das sog. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), verabschiedet. Mit dem Gesetz wird die Richtlinie (EU) 2019/882 nahezu eins zu eins in nationales Recht umgesetzt.
- Das Gesetz stellt erstmals grundlegende Anforderungen an die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen auf, die von den betroffenen Wirtschaftsakteuren – von bestimmten Ausnahmen abgesehen – ab dem 28. Juni 2025 einzuhalten sind. Produkte, die nach dem 28. Juni 2025 in Verkehr gebracht werden, bzw. Dienstleistungen, die nach diesem Stichtag erbracht werden, müssen die Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen.
- Neben Anforderungen an Dienstleistungen für Verbraucher normiert das Gesetz erhebliche neue Pflichten und Vorgaben für Hersteller, Importeure und Händler von bestimmten Verbraucher-Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie. So sind vom Anwendungsbereich des Gesetzes insbesondere Computer, Tablets, Smartphones, Smart-TVs, E-Books, Router, Streaming-Sticks etc. erfasst.
- Im Bereich der Dienstleistungen findet das Gesetz u. a. auf Telefondienste, Messenger-Dienste, E-Books oder den elektronischen Geschäftsverkehr Anwendung. Die Barrierefreiheitsanforderungen an Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr gelten insbesondere für den Online-Verkauf von Produkten und Dienstleistungen und erfassen jene Dienstleistungen, die über Websites
oder Apps im Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrages erbracht werden. - Die konkret einzuhaltenden Kriterien der Barrierefreiheit sind im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz jedoch nicht niedergelegt. Die genauen Barrierefreiheitsanforderungen müssen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in einer noch zu erlassenen Rechtsverordnung festgelegt werden.
- Ausgehend von der Richtlinie und der Gesetzesbegründung soll die „digitale Barrierefreiheit“ aber u. a. dadurch erreicht werden, dass Informationen über mehrere sensorische Kanäle sowie in verständlicher Weise und Darstellung bereitgestellt werden und die Nutzung von Produkten dadurch ermöglicht wird, dass stets alternative Darstellungs- und Steuerungsweisen zur Verfügung stehen.
- Die Barrierefreiheitsanforderungen werden Teil des Konformitätsbewertungsverfahrens eines Produktes sein und entsprechend in der EU-Konformitätserklärung anzugeben sein. Zudem unterliegen die dem Anwendungsbereich des Gesetzes unterfallenden Produkte der CE-Kennzeichnung.
- Ausnahmen sieht das Gesetz für Kleinstunternehmen (d. h. Unternehmen, die weniger als zehn Personen beschäftigen und deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme EUR 2 Mio. nicht übersteigt) sowie für Fälle vor, in denen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und Innovationsfreiheit die Barrierefreiheitsanforderungen nicht eingehalten werden müssen.
- Für die behördliche Kontrolle und Durchsetzung der Vorgaben des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes sind die Marktüberwachungsbehörden der Bundesländer zuständig. Sie überprüfen, ob die Barrierefreiheitsanforderungen eingehalten werden und ob von den Ausnahmeregelungen, die das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vorsieht, ordnungsgemäß Gebrauch gemacht wurde. Sie können bei Verstößen den jeweiligen Wirtschaftsakteur dazu verpflichten, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen oder die Bereitstellung des Produktes / die Erbringung einer Dienstleistung auf dem deutschen Markt einzuschränken oder zu untersagen. Verstöße können zudem als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu EUR 100.000 geahndet werden.
- Das Gesetz sieht zudem ein Klagerecht für betroffene Verbraucher vor sowie ein eigenes Verbandsklagerecht für Verbände und qualifizierte Einrichtungen.
Praxistipp: Um über den 28. Juni 2025 hinaus weiterhin rechtskonforme Produkte und Dienstleistungen anbieten und erbringen zu können, sollten sich betroffene Wirtschaftsakteure schon jetzt mit den Vorgaben des Gesetzes auseinandersetzen. Vor allem für Hersteller von IKT-Produkten kann das Gesetz erhebliche Auswirkungen haben. Die Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen kann wesentliche Änderungen an Elektronikprodukten notwendig machen. Hersteller werden zukünftig bereits in der Entwicklungsphase der Produkte die neuen Vorgaben berücksichtigen und entsprechende Vorkehrungen an Hardware und Software treffen müssen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gestaltet und hergestellt werden.
Wir haben die wesentlichen Inhalte des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes auch in einem Blogbeitrag zusammengefasst und analysiert.
Zahlungsplattformen, Abrechnungsmodelle und das Finanztransfergeschäft
- Die Abrechnung von Handelsgeschäften sowie die Administration und das Monitoring von Zahlungseingängen, Provisionszahlungen oder Kommissionsgeschäften ist ein Aufwand, den viele Unternehmen als lästig empfinden. Die Angebote für Abrechnungsservices und auch die Zunahme von Handelsplattformen hat dazu geführt, dass sich etliche Geschäftsmodelle entwickelt haben, die letztlich auf der Idee basieren, dass der Aufwand für Administration gering bleibt. Tatsächlich ist aber Service „rund um den Zahlungsverkehr“ häufig reguliert und Unternehmen außerhalb des Finanzsektors laufen Gefahr, hierdurch unbeabsichtigt mit dem Aufsichtsrecht in Berührung zu kommen. In diesem Kontext wird dann häufig Finanztransfergeschäft betrieben oder man hat sich daran beteiligt, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Der Tatbestand ist tatsächlich auch schwer zu greifen und kann bereits in vermeintlich alltäglichen Situationen erfüllt sein.
- Das Finanztransfergeschäft wird definiert als Dienst, bei dem ohne Einrichtung eines Zahlungskontos auf den Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers ein Geldbetrag des Zahlers nur zur Übermittlung eines entsprechenden Betrags an einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister entgegengenommen wird oder bei dem der Geldbetrag im Namen des Zahlungsempfängers entgegengenommen und diesem verfügbar gemacht wird. Vereinfacht lässt sich dies als Dienstleistung beschreiben, bei der ohne Einrichtung eines Zahlungskontos ein Geldbetrag des Zahlers an einen Zahlungsempfänger übermittelt wird. Erfasst wird damit das „Weiterleiten“ von Geldbeträgen.
- Einer Reihe von Geschäftsmodellen ist die Gefahr immanent, erlaubnispflichtiges Finanztransfergeschäft zu sein. Insbesondere die folgenden Konstellationen bergen diese Gefahr:
- Konzentration verschiedener Leistungen auf einer Plattform – „Du zahlst an uns, wir kümmern uns um den Rest“: Das Modell der Bündelung von Leistungen ist für Unternehmen und Kunden gleichermaßen attraktiv und erfreut sich besonderer Beliebtheit. Dabei erfüllt aber der zahlungsentgegennehmende „Marketplace“ regelmäßig die Rolle des Mittlers, der Geldbeträge an die Akteure der Plattform übermittelt.
- Zahlungsströme innerhalb einer Konzerngruppe – „Der Kunde soll nur einen Ansprechpartner haben“: Auch bei Zahlungsabwicklungen innerhalb einer Unternehmensgruppe kann die Übermittlung von Geldbeträgen erlaubnispflichtig sein. Hier ist detailliert zu prüfen, ob das Geschäftsmodell in den Anwendungsbereich des sog. Konzernprivilegs aus § 2 Abs. 1 Nr. 13 ZAG fällt. Ist dies der Fall, können die Zahlungsströme in der Gruppe erlaubnisfrei abgewickelt werden.
- Makler- und Vermittlungstätigkeiten – „Die Zahlung läuft dann über uns und wir erhalten 10 % Marge“: Um den Erhalt der eigenen Marge zu sichern und ein Umgehen des Vermittlers zu verhindern, ist eine direkte Zahlung im vermittelten Vertragsverhältnis oftmals unerwünscht. Auch Unternehmen, die die Vermittlung von Leistungen zum Gegenstand haben, laufen daher oftmals Gefahr, in den Anwendungsbereich des Aufsichtsrechtes zu fallen.
- Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist zuständig für die Aufsicht über Zahlungsdienstleister und hat das Bekämpfen unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäftes zu einem Aufsichtsschwerpunkt erklärt. Eine Erlaubnis zu erhalten ist aufwendig. Es muss ein umfangreiches Verwaltungsverfahren durchlaufen werden, in dessen Rahmen vor allem das Geschäftsmodell, die Geschäftsleiter, die Eigentümer des Unternehmens und dessen Kapitalisierung von der Aufsicht überprüft werden. Dabei kommen auf den Antragssteller auch erhebliche Kosten zu und nach der Erlaubniserteilung müssen die Kosten der laufenden Aufsicht finanziert werden.
- Die Erbringung des Finanztransfergeschäfts ohne entsprechende Erlaubnis zieht außerdem regelmäßig aufsichtsrechtliche Konsequenzen nach sich. Die Palette behördlicher Sanktionsbefugnisse reicht dabei von der Anordnung der Einstellung und Rückabwicklung des Geschäftsbetriebes über die öffentliche Bekanntmachung aller getroffenen Maßnahmen auf der Homepage der Behörde am sog. „BaFin-Pranger“ bis hin zur Verhängung von Sanktionen gegen die Geschäftsleiter einschließlich möglicher Freiheitsstrafen und Bußgelder.
- Es ist daher unbedingt empfehlenswert, jedes Geschäftsmodell, das die Übermittlung von Geldbeträgen zum Gegenstand hat und mehr als zwei Parteien involviert, einer aufsichtsrechtlichen Überprüfung zu unterziehen und sich vor der Anwendung des Modells mit der Regulatorik vertraut zu machen, um die Grenzen im eigenen Modell zu kennen. Darüber hinaus kann es, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, auch attraktiv sein, eine Erlaubnis zu beantragen und damit ein neues Geschäftsmodell zu etablieren.