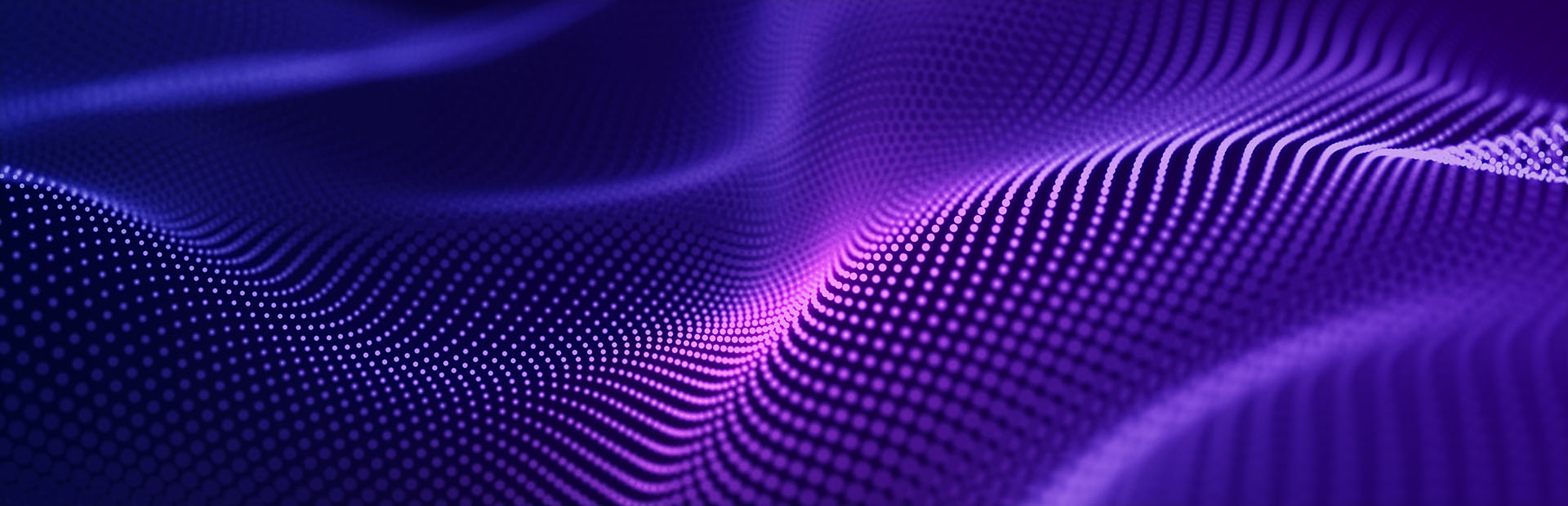Update Commercial 04/2021

Autoren
Nach wie vor werden wir von der Covid-19-Pandemie bzw. ihren Nachwirkungen begleitet. Mit diesem Newsletter wollen wir Ihre Aufmerksamkeit weg von der Covid-19-Pandemie und hin zu einigen aktuellen Entwicklungen aus Rechtsprechung und Gesetzgebung lenken, die Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung haben. So hat beispielsweise der BGH eine Kehrtwende in seiner Rechtsprechung zu Kaskadenverweisen in Widerrufsbelehrungen vollzogen. Daneben gibt es eine aktuelle Entscheidung des BGH zur Einbeziehung einer Schiedsabrede in internationale AGB. Schließlich steht eine spannende Entscheidung des EuGH an: Er wird aufgrund einer Vorlage durch den BGH darüber entscheiden, inwiefern Internethändler dazu verpflichtet sind, über Herstellergarantien zu informieren. Im Bereich der Gesetzgebung sei insbesondere auf den Regierungsentwurf für ein Lieferkettengesetz hingewiesen sowie auf die Änderungen durch die 10. GWB-Novelle. Im Bereich Compliance verdient der Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes Beachtung. Diese und andere interessante Entscheidungen und Gesetzentwürfe besprechen wir in diesem Newsletter.
All denjenigen, die Interesse an der Umsetzung der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt der Europäischen Kommission haben, sei unser aktueller Blog-Beitrag „Neues Mängelrecht für Verträge über digitale Produkte“ in der Reihe „Verbraucherverträge im Digitalzeitalter“ empfohlen.
Inhalt
Im Folgenden finden Sie die Themen des Newsletters.
Aktuelle Rechtsprechung
- BGH vollzieht Kehrtwende zu Kaskadenverweisen in Widerrufsbelehrungen
- CMR: Erweiterung der Haftung des Frachtführers
- BGH: Einbeziehung einer Schiedsabrede in „internationalen“ AGB
- EuGH entscheidet nun über Pflicht für Händler zum Hinweis auf bestehende Herstellergarantien
- Fiktive Mängelbeseitigungskosten – im Kaufrecht auch künftig taugliche Grundlage für die Schadensberechnung
- Anforderungen an die Kündigung eines Agenturvertrags auf dem Gebiet der Sportvermarktung
- Landgericht Flensburg untersagt Lockangebot auf Online-Plattform wegen Frustrationsrisiko
Gesetzgebung und Trends
- Regierungsentwurf für Lieferkettengesetz vorgelegt
- Compliance Defense in der 10. GWB-Novelle
- Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes: Unternehmen sollen künftig zur Errichtung eines Meldesystems verpflichtet sein
- Verbot des Inverkehrbringens von Einwegkunststoffprodukten ab Juli 2021
- Internationale Handelssachen: Hamburg und NRW wollen Deutschland als Gerichtsstandort für Wirtschaftsstreitigkeiten stärken
Bei Interesse können Sie das Update Commercial hier abonnieren.
Aktuelle Rechtsprechung
BGH vollzieht Kehrtwende zu Kaskadenverweisen in Widerrufsbelehrungen
(BGH, Urteil v. 27. Oktober 2020 – XI ZR 498/19, und BGH, Urteil v. 27. Oktober 2020 – XI ZR 525/19)
- Der BGH hat in Abkehr seiner bisherigen Rechtsprechung jüngst in zwei Fällen entschieden, dass eine Widerrufsbelehrung, die eine Norm anführt, die wiederum auf einen weiteren Paragraphen verweist, weder ausreichend klar noch verständlich ist. Ein derartiger Kaskadenverweis vermag den Beginn der Widerrufsfrist von Verbraucherverträgen folglich nicht in Gang zu setzen, jedenfalls dann nicht, wenn auch die Gesetzlichkeitsfiktion nach Art. 247 § 6 Abs. 2 Satz 3 EGBGB nicht greift.
- Den Entscheidungen lag jeweils der Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs zugrunde, bei dem neben dem Kaufvertrag zugleich ein sogenannter verbundener Darlehensvertrag zur (Teil-)Finanzierung des Fahrzeugs abgeschlossen worden war. Nach neun bzw. fast 21 Monaten widerriefen die Käufer ihre auf den Abschluss des Verbraucherdarlehensvertrags gerichteten Willenserklärungen und beriefen sich dabei auf die fehlerhafte Widerrufsbelehrung der Kreditgeber. Die Widerrufsbelehrungen verwiesen jeweils auf § 492 Abs. 2 BGB, der wiederum seinerseits auf Art. 247 §§ 6–13 EGBGB verwies. Die verwendeten Widerrufsbelehrungen wichen allerdings vom Muster in Anlage 7 zu Art. 247 § 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 EGBGB dahingehend ab, dass die Kreditgeber in der Widerrufsinformation als mit dem Darlehensvertrag verbundenen Vertrag nicht nur den Fahrzeugkaufvertrag, sondern – zu Unrecht – auch einen Vertrag über eine Restschuldversicherung mit angegeben hatten, den die Käufer indes gar nicht abgeschlossen hatten.
- Der BGH ist nunmehr doch der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs gefolgt, wonach ein derartiger Kaskadenverweis gegen die Richtlinie 2008/48/EG über Verbraucherkreditverträge verstößt, weil die gebotene Belehrung hierdurch unverständlich wird. Zuvor hatte der BGH diese Sichtweise ausdrücklich noch nicht geteilt. Die gebotene europarechtskonforme Auslegung der deutschen Vorschriften in § 492 Abs. 2 BGB und Art. 247 § 6 EGBGB – so der BGH – führe dazu, dass ein Kaskadenverweis in der Widerrufsbelehrung nicht klar und verständlich ist.
- Der BGH hat in den beiden ihm zur Entscheidung vorliegenden Fällen auch ausgeführt, dass sich die Kreditgeber auch nicht auf die sog. Gesetzlichkeitsfiktion nach Art. 247 § 6 Abs. 2 EGBGB berufen können, wonach eine Vertragsklausel, die dem Muster in Anlage 7 zu Art. 247 § 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 EGBGB entspricht, immer die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Die Gesetzlichkeitsfiktion kann in den vorliegenden Fällen – so der BGH – schon deshalb nicht greifen, weil die Widerrufsbelehrungen vom Muster abwichen, hatten die Kreditgeber in den Widerrufsbelehrungen doch noch weitere, hier nicht abgeschlossene Versicherungsverträge, mit aufgeführt. Ob im Umkehrschluss daraus abgeleitet werden kann, dass Kaskadenverweise aufgrund der Gesetzlichkeitsfiktion unschädlich sind, wenn die Widerrufsbelehrung exakt dem Muster in Anlage 7 zu Art. 247 § 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 EGBGB entspricht, bleibt zunächst offen. In der Praxis sind solche Übereinstimmungen indes die Ausnahme.
- Der BGH hat die Entscheidungen im Übrigen an das Berufungsgericht zurückgewiesen. Das Berufungsgericht hat sich insbesondere noch mit den von den Kreditgebern erhobenen Rechtsmissbrauchseinwänden zu befassen, sprich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Käufer der Fahrzeuge vorliegend ihr Widerrufsrecht nicht möglicherweise missbraucht und damit gegen § 242 BGB verstoßen haben, indem sie sich auf das Fehlen des Musterschutzes (Art. 247 § 6 Abs. 2 Satz 3 EGBGB) berufen haben.
Praxistipp: Die Rechtsprechungsänderung des BGH auf die Linie des Europäischen Gerichtshofs dürfte zukünftig Wasser auf die Mühlen derjenigen sein, die das Urteil des EuGH vom 26. März 2020 zur Unvereinbarkeit des sog. Kaskadenverweises in einer Widerrufsbelehrung mit der Verbraucherkreditrichtlinie als Comeback des „Widerruf-Jokers“ von Verbrauchern gefeiert haben. Abzuwarten bleibt freilich, ob das Berufungsgericht den Käufern vorliegend nicht doch noch über § 242 BGB einen Riegel vorschiebt. Im Übrigen schadet der Kaskadenverweis bei ordnungsgemäßer Verwendung der Muster-Widerrufsbelehrung nicht. Davon abgesehen wird sich angesichts der mit dem Widerruf verbundenen Rechtsfolgen und einer potentiellen Wertersatzpflicht des Darlehensnehmers vielfach die Frage stellen, ob der Widerruf tatsächlich im Interesse des Darlehensnehmers liegt.
CMR: Erweiterung der Haftung des Frachtführers
(BGH, Urteil v. 17. Dezember 2020 – I ZR 130/19)
- Der BGH setzte sich in diesem Verfahren mit den formalen Anforderungen an die Erweiterung der Haftung des Frachtführers gemäß der „Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road“ (CMR) auseinander.
- Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Klägerin beauftragte das beklagte Speditionsunternehmen mit der Verpackung eines Kunstwerkes und dem Transport von Großbritannien nach Deutschland. Dieser Auftrag umfasste den Abschluss einer Transportversicherung mit einem Versicherungswert von EUR 200.000 sowie die Vereinbarung der „Allgemeinen Vertragsbedingungen Kunst“ (AVK). Die Beklagte übernahm das Kunstwerk in unbeschädigtem Zustand und verpackte dieses. Bei Ankunft wies es eine irreparable Beschädigung auf. Die Parteien streiten um den nach CMR geschuldeten Schadensersatz.
- Der BGH entschied, dass die Beklagte dem Grunde nach gemäß Art. 17 Abs. 1 CMR hafte, da das Werk in ihrer Obhut Schaden genommen habe. Auf Art. 17 Abs. 4 CMR, der eine Haftungsbefreiung vorsieht, wenn die Beschädigung auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen ist, könne sie sich nicht berufen. Denn schließlich habe die Beklagte das Werk selbst verpackt.
- Anders als die Vorinstanz lässt der BGH die bisherigen Feststellungen nicht für eine Erweiterung der Haftung des Spediteurs auf den Versicherungswert von EUR 200.000 genügen. Denn um seinen Haftungsumfang nach Art. 24 und 26 Abs. 1 CMR zu erhöhen, bedarf es laut BGH jeweils der Eintragung der Wert- oder Interessenangabe im Frachtbrief. Außerdem müsse die Erhöhung des Haftungshöchstbetrages zwischen den Parteien des Frachtvertrages vereinbart worden sein. Für eine solche Vereinbarung genüge nicht allein die Einigung über den Abschluss einer Transportversicherung gegen Aufpreis sowie die Angabe des Versicherungswertes im Frachtvertrag. Die Vorinstanz muss sich daher insbesondere unter Berücksichtigung der AVK erneut damit beschäftigen, ob eine solche Einigung hier vorlag.
- Schließlich weist der BGH darauf hin, dass eine Beschädigung der ganzen Sendung gemäß Art. 25 Abs. 2 lit. a CMR nicht nur bei einem wirtschaftlichen Totalschaden der kompletten Sendung vorliege. Vielmehr sei eine Beschädigung der ganzen Sendung auch anzunehmen, wenn die Beschädigung die ganze Sendung erfasse und in ihrem Wert zumindest verringere. Dies könne bspw. auch im Falle der irreparablen Beschädigung einzelner Stücke einer Sachgesamtheit der Fall sein.
Praxistipp: Allein die Einigung über den Abschluss einer Transportversicherung und die Angabe des Versicherungswertes im Frachtvertrag genügen nicht für eine Erhöhung der Haftungsgrenzen nach der CMR. Will der Kunde eine solche Erhöhung erreichen, muss diese „neue“ Grenze in den Frachtbrief aufgenommen werden und die Parteien müssen sich über diese Erhöhung einigen. Diese Einigung sollte schriftlich dokumentiert werden.
BGH: Einbeziehung einer Schiedsabrede in „internationalen“ AGB
(BGH, Urteil v. 26. November 2020 – I ZR 245/19)
- Der BGH befasste sich hier mit der wirksamen Einbeziehung einer Schiedsabrede in drei Kaufverträge, die zwischen einem deutschen Käufer und einer niederländischen Verkäuferin abgeschlossen worden waren. Die Versicherung der Käuferin nahm die Verkäuferin wegen angeblicher Mängel aus übergegangenem Recht vor dem Landgericht Bremen in Anspruch. Sie erwirkte dort zunächst ein Versäumnisurteil gegen die Beklagte.
- Die Beklagte erhob im Rahmen des Einspruchs erstmals die Schiedseinrede. Sie verwies dabei auf ihre allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese enthielten eine Schiedsklausel zugunsten niederländischer Schiedsgerichte (und eine Rechtswahlklausel mit einem Ausschluss des CISG). Die Beklagte hatte in ihrer Verkaufsbestätigung auf diese Geschäftsbedingungen verwiesen. Diese Bestätigung hatte die Beklagte der Klägerin geschickt – unstreitig wurden aber weder die Verkaufsbedingungen selbst der Käuferin überreicht noch wurde die zugesandte Verkaufsbestätigung von der Käuferin gegengezeichnet.
- Der BGH hat entschieden, dass die Parteien keine wirksame Schiedsabrede getroffen hatten. Zwar sei die Rüge nach § 1032 Abs. 1 ZPO auch dann noch rechtzeitig, wenn sie erst vor der mündlichen Verhandlung und nicht schon innerhalb der Klageerwiderungsfrist erhoben wird.
- Allerdings sei die Schiedsvereinbarung nicht wirksam getroffen worden. Art. II Abs. 2 des „New Yorker Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche“ (UNÜ) erfordere, dass die Schiedsabrede von beiden Parteien unterzeichnet wird oder in zwischen den Parteien gewechselter Korrespondenz enthalten ist. Beides sei hier nicht der Fall gewesen. Daher könne gemäß Art. VII Abs. 1 UNÜ für die Frage der materiellen Einigung auf das nationale Sachrecht oder Kollisionsrecht (Meistbegünstigungsgrundsatz) zurückgegriffen werden.
- Der BGH prüfte folglich, ob die AGB der Verkäuferin, die die Schiedsabrede enthielten, nach deutschem Sachrecht einschließlich CISG wirksam in den Vertrag einbezogen worden waren. Das CISG sei auf die Frage, ob die Schiedsvereinbarung materiell wirksam zustande gekommen sei, anwendbar. Da die AGB indes nicht übersandt worden waren, seien sie nach dem CISG nicht wirksam einbezogen worden. Dasselbe gelte bei Anwendung niederländischen Rechts (einschließlich des CISG).
Praxistipp: Die Entscheidung zeigt, dass bei der Einbeziehung von AGB im internationalen Rechtsverkehr Vorsicht geboten ist. Soll eine Schiedsabrede in AGB grenzüberschreitend vereinbart werden, ist zu empfehlen, diese AGB der Vertragspartei zur Verfügung zu stellen und sich den Erhalt schriftlich bestätigen zu lassen. Anderenfalls läuft der Verwender Gefahr, sich nicht auf die Schiedsklausel berufen zu können und einer Klage vor einem ausländischen Gericht ausgesetzt zu sein.
EuGH entscheidet nun über Pflicht für Händler zum Hinweis auf bestehende Herstellergarantien
(BGH, Beschluss v. 11. Februar 2021 – I ZR 241/19)
- Nachdem das OLG Hamm entschieden hatte, dass Onlinehändler und stationäre Verkäufer verpflichtet sind, über das Bestehen und die Bedingungen von Garantien zu informieren (wir berichteten im Update Commercial 02/2020), hat der BGH als Revisionsinstanz zu dem vom OLG Hamm entschiedenen Verfahren nun dem EuGH drei Fragen zum Bestehen und zum Umfang einer Pflicht von Internethändlern zur Information über Herstellergarantien vorgelegt.
- Zuerst fragt der BGH, ob schon das bloße Bestehen einer Herstellergarantie die Informationspflicht auslöst. Die den deutschen Vorschriften zugrunde liegende Richtlinie ermöglicht nach dem BGH keine eindeutige Beantwortung dieser Rechtsfrage. Die Richtlinie schreibt (wie die deutsche Umsetzung) insofern vor, dass der Unternehmer den Verbraucher „gegebenenfalls“ über das Bestehen und die Bedingungen von Garantien zu informieren hat. Dabei scheitert eine eindeutige Auslegung an der unklaren Bedeutung des Wortes „gegebenenfalls“.
- Für den Fall, dass die erste Vorlagefrage verneint wird, fragt der BGH, welche Form und welchen Umfang eine Erwähnung einer Herstellergarantie ohne werbliche Hervorhebung im Angebot des Verkäufers haben muss, um die Informationspflicht auszulösen.
- Schließlich fragt der BGH, welche Angaben die Information über Herstellergarantien enthalten muss. Insofern ist bislang nicht höchstrichterlich geklärt, ob die vorvertraglichen Informationen alle Angaben enthalten müssen, die die Garantieerklärung selbst umfassen muss.
Praxistipp: Nicht nur die Werbung mit einer Herstellergarantie begegnet hohen rechtlichen Anforderungen (dazu Werbung mit Herstellergarantie: Rechtsanspruch (cmshs-bloggt.de)). Auch ohne werbliche Hervorhebung, vielleicht sogar ohne jede Hervorhebung, könnte allein das bloße Bestehen einer Herstellergarantie die Pflicht auslösen, hierüber zu informieren. Insofern bleibt die Entscheidung des EuGH abzuwarten. Bis diese Rechtsfrage entschieden ist, ist zu empfehlen, über etwaige Garantien in einer Weise zu informieren, die den Anforderungen des § 479 Abs. 1 BGB genügt (dazu bereits der Praxistipp zum Urteil des LG Weiden, August-Update 2019). Dabei trifft die Informationspflicht nach Auffassung des BGH auch stationäre Verkäufer, soweit es nicht um Geschäfte des täglichen Lebens geht, die bei Vertragsschluss sofort erfüllt werden. Im Online-Handel muss die Information mediengerecht erfolgen. Danach kann die Informationspflicht mithilfe eines Links erfüllt werden, wenn dieser in klarer und verständlicher Sprache bezeichnet und in einen ebenfalls klaren inhaltlichen Kontext eingebettet ist. Einen anschaulichen Fall einer intransparenten Bewerbung betrifft ein Urteil des OLG Nürnberg.
Fiktive Mängelbeseitigungskosten – im Kaufrecht auch künftig taugliche Grundlage für die Schadensberechnung
(BGH, Beschluss v. 12. März 2021 – V ZR 33/19)
- Der V. Zivilsenat des BGH hat in seinem Urteil vom 12. März 2021 (V ZR 33/19) entschieden, dass der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung (kleiner Schadensersatz) aus §§ 280 Abs. 1, 281 Abs. 1 BGB im Kaufrecht weiterhin anhand der fiktiven Mängelbeseitigungskosten berechnet werden kann. Es können also die voraussichtlich entstehenden Mängelbeseitigungskosten geltend gemacht werden, auch wenn diese (bis dahin) nicht aufgewendet wurden. Er gab damit dem Käufer einer renovierten Immobilie Recht, bei der sich im Nachhinein Mängel gezeigt hatten, für die der Verkäufer auf Schadensersatz haftete.
- Damit werden Unterschiede bei der Schadensberechnung im Kaufvertragsrecht und im Werkvertragsrecht zementiert. Denn der für das Werkvertragsrecht zuständige VII. Zivilsenat hatte in seinem vielbeachteten Urteil vom 22. Februar 2018 – VII ZR 46/17 seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben und entschieden, dass der kleine Schadensersatz im Werkvertragsrecht nicht auf Grundlage von fiktiven Mängelbeseitigungskosten bemessen werden darf (vgl. hierzu das Update Commercial Februar-Ausgabe 2019, CMS Bloggt und Update Real Estate & Public September 2018).
- Auf Anfrage des V. Zivilsenats bestätigte der VII. Zivilsenat diese neue Rechtsprechung im Werkvertragsrecht (Beschluss v. 8. Oktober 2020 – VII ARZ 1/20). Weil diese Rechtsprechung mit Besonderheiten des Werkvertragsrechts begründet wird, waren die beiden Zivilsenate nicht gezwungen, eine einheitliche Linie zu finden.
- Damit ist bis auf weiteres eine unterschiedliche Behandlung fiktiver Mängelbeseitigungskosten im Kaufrecht einerseits und im Werkvertragsrecht andererseits perpetuiert. Die Rechtsprechung des V. Zivilsenats zur Ersatzfähigkeit fiktiver Mängelbeseitigungskosten im Kaufrecht hat sich insbesondere in Streitfällen zum Kauf von Immobilien herausgebildet. Wesentliches Argument des BGH dafür, im Kaufrecht an der Ersatzfähigkeit von fiktiven Mängelbeseitigungskosten festzuhalten, ist es, dass andernfalls der Käufer bei der Mängelbeseitigung in Vorleistung treten müsste. Denn anders als im Werkvertragsrecht gibt es im Kaufrecht keinen Anspruch auf einen Vorschuss für eine Selbstvornahme. Dem zum Schadensersatz berechtigten Käufer ein Vorfinanzierungsrisiko für die Mangelbeseitigung aufzuerlegen, sei nicht sachgerecht.
- Eine mittelbare Folge dieser Vorgehensweise ist, dass ein Käufer vom schadensersatzpflichtigen Verkäufer die vollen Kosten für eine Mangelbeseitigung verlangen kann, auch wenn er auf eine Beseitigung des Mangels verzichtet. Der V. Zivilsenat führt hierzu aus, es sei – jedenfalls für das Kaufrecht – nicht erkennbar, dass das zu unangemessenen Ergebnissen geführt hätte.
Praxistipp: Bei der Berechnung von Schadensersatzansprüchen wegen mangelhafter Leistung wird, wenn Mängelbeseitigungskosten zwar vorab ermittelt wurden (z. B. in einem Gutachten), aber noch nicht angefallen sind, künftig je nach Vertragstyp zu differenzieren sein: Während die Kosten aus einem Gutachten im Kaufrecht grundsätzlich ersatzfähig sind, auch wenn der Käufer keine Mangelbeseitigung veranlassen will, kann der Besteller unter einem Werkvertrag nur dann einen Vorschuss für eine Selbstvornahme einfordern, wenn eine solche auch durchgeführt werden soll. Andernfalls kann er (nur) einen mangelbedingten Minderwert des Werkes als Schaden geltend machen, der deutlich geringer sein kann als die Kosten für eine Mangelbeseitigung.
Weder die neue Entscheidung des V. Zivilsenats noch die Rechtsprechung des VII. Zivilsenats betreffen die Frage nach der Ersatzfähigkeit fiktiver Reparaturkosten nach einem Sachschaden. Es ist nicht erkennbar, dass die Überlegungen zum Recht der Kaufmängel oder Werkmängel unmittelbar übertragbar wären auf den rechtlichen Umgang mit Schadensfällen, der insbesondere durch die Rechtsprechung zum Verkehrsrecht geprägt wird.
Anforderungen an die Kündigung eines Agenturvertrags auf dem Gebiet der Sportvermarktung
(OLG Karlsruhe, Urteil v. 14. Oktober 2020 – 15 U 137/19)
- Der OLG-Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Karlsruher Sportclub (KSC) und eine Agentur für Sportrechte hatten einen Vertrag geschlossen. Danach war die Agentur beauftragt, Werbe- und Marketingrechte auf Provisionsbasis exklusiv zu vermarkten. Die Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung sowie das Recht zur fristlosen Kündigung bei Vertrauensstellung (§ 627 Abs. 1 BGB) wurde ausgeschlossen. Dennoch kündigte der Karlsruher Sportclub unter Berufung auf § 627 Abs. 1 BGB und teilte seinen Geschäftspartnern per E-Mail mit, dass die Zusammenarbeit mit der Agentur in Kürze beendet sei. Die Agentur wies in einer eigenen E-Mail denselben Adressatenkreis auf die nach ihrer Sicht bestehende Unwirksamkeit der Kündigung hin. Wegen dieser E-Mail kündigte der KSC die Zusammenarbeit nochmals außerordentlich.
- Eine Agentur für professionelle Sportvermarktung erbringt Dienste höherer Art im Sinne des § 627 Abs. 1 BGB, wenn sie die Verhandlungsführung und Angebotserstellung bei größeren Werbeverträgen, wie z. B. Trikotwerbung, übernimmt.
- Ein entsprechender Agenturvertrag kann nach § 627 Abs. 1 BGB gekündigt werden. Jedenfalls dann, wenn ein einheitlicher Vertrag auch auf die Leistung höherer Dienste gerichtet ist, wird § 627 Abs. 1 BGB nicht durch § 89 a Abs. 1 HGB verdrängt. Das Kündigungsrecht nach § 627 Abs. 1 BGB kann grundsätzlich individualvertraglich, nicht aber durch AGB, wirksam abbedungen werden.
- Die Prüfung, ob das Kündigungsrecht nach § 627 Abs. 1 BGB individualvertraglich oder durch AGB abbedungen wurde, erfolgt anhand des Maßstabs des § 305 Abs. 1 BGB. Danach sind AGB alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. „Stellen“ liegt vor, wenn die Formularbestimmungen auf Initiative einer Partei in die Verhandlungen eingebracht werden und ihre Verwendung zum Vertragsabschluss verlangt wird. Der Ausschluss des Kündigungsrechts nach § 627 Abs. 1 BGB entsprach dem Stand der bereits begonnenen, vom KSC maßgeblich geprägten Verhandlungen. Denn schon die vom KSC durchgeführte Ausschreibung sah eine Vertragsstruktur mit dem Ausschluss des Kündigungsrechts gemäß § 627 Abs. 1 BGB vor. Somit hat die Agentur die Klausel, wonach das Kündigungsrecht nach § 627 Abs. 1 BGB ausgeschlossen ist, nicht gestellt.
- Eine weitere Voraussetzung für die Annahme von AGB ist, dass die Klausel nicht im Einzelnen zwischen den Parteien ausgehandelt worden ist, § 305 Abs. 1 S. 3 BGB. Ein Aushandeln liegt vor, wenn der Verwender den gesetzesfremden Kerngehalt der Klausel ernsthaft zur Disposition stellt und dem Verhandlungspartner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Interessen einräumt. Ein solches Aushandeln nimmt das OLG Karlsruhe hier an, auch wenn die Klausel während der Verhandlungen nicht explizit angesprochen wurde und inhaltlich unverändert blieb. Im Ergebnis war also das Kündigungsrecht nach § 627 Abs. 1 BGB wirksam ausgeschlossen worden.
- Eine außerordentliche Kündigung nach § 626 Abs. 1 BGB setzt einen wichtigen Grund voraus. Dieser liegt vor, wenn dem Kündigenden die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht zugemutet werden kann. Bei dieser Abwägung kann auch das Gewicht einer Pflichtverletzung bedeutsam sein. Im vorliegenden Fall lag die Pflichtverletzung der Agentur darin, dass diese in ihrer E-Mail an die Werbepartner die unrichtige Behauptung aufgestellt hatte, der KSC habe Gesprächsangebote über die Kündigung ausgeschlagen. Die Pflichtverletzung durch die Agentur konnte keine Unzumutbarkeit der Fortführung des Vertrags bis zum Ablauf der vorgesehenen Vertragslaufdauer begründen, zumal die vorausgegangene E-Mail des KSC ebenfalls unzutreffende Behauptungen enthalten hatte.
Praxistipp: Vertragsparteien haben die Möglichkeit, das Kündigungsrecht nach § 627 Abs. 1 BGB individualvertraglich auszuschließen. Dies ermöglicht eine feste schuldrechtliche Bindung bei Vertrauensstellung des zur Dienstleistung Verpflichteten, wenn zusätzlich die Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen wird. Je nach Ausgestaltung der Vergütung und etwaigen Investitionen kann so ein austariertes Verhältnis zwischen Vergütungshöhe und Vertragslaufzeit entstehen. Entscheiden sich die Vertragsparteien für einen Ausschluss des Rechts zur ordentlichen Kündigung und des Kündigungsrechts nach § 627 Abs. 1 BGB, kann die Bindung nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gelöst werden. Der Vertragspartei, die kündigen will, ist dringend zu empfehlen, die Wirksamkeit einer Kündigung zu prüfen, da sie bei einer unberechtigten Kündigung zum Schadensersatz verpflichtet ist.
Landgericht Flensburg untersagt Lockangebot auf Online-Plattform wegen Frustrationsrisiko
(LG Flensburg, Urteil v. 19. März 2021 – 6 HKO 57/20)
Wenn ein Händler mit einem begehrten Markenprodukt Kunden anlocken will, aber auf Bestellung nicht liefern kann, ist das für die Verbraucher frustrierend und i. d. R. als unzureichende Aufklärung über die fehlende Lieferfähigkeit zu verbieten. Das Landgericht Flensburg hat dies in einem Urteil vom 19. März 2021 ausführlich begründet (6 HKO 57/20).
- Die Verfügungsklägerin vertreibt Parfümerieprodukte einer bekannten Marke über ein selektives Vertriebssystem ausschließlich über eigene Tochtergesellschaften oder autorisierte Vertragshändler. Die Verfügungsbeklagte ist von der Verfügungsklägerin nicht zum Verkauf ihrer Parfümerieprodukte autorisiert und kann sich diese allenfalls auf dem sog. Graumarkt beschaffen. Sie hat im Dezember 2020 auf „real.de“ mit dem Hinweis „nur noch 3 Stück auf Lager“ ein bestimmtes Parfum der Verfügungsklägerin angeboten. Daraufhin hat eine Testkundin das Parfum bestellt und kurze Zeit später die Mitteilung erhalten, dass die Bestellung des Artikels mit folgender Begründung storniert worden sei: „Leider ist es bei diesem Produkt im Verlauf der letzten Tage immer wieder zu Problemen bei den Abstimmungen der Bestände gekommen. Daher wurde der von Ihnen bestellte Artikel noch als verfügbar angezeigt, obwohl dieser bereits ausverkauft war.“
- Die Verfügungsbeklagte hat behauptet, ihre Verkäufe seien aufgrund eines technischen Fehlers im Warenwirtschaftssystem, das eigentlich einwandfrei funktioniere, nicht zutreffend gebucht worden. Es seien Lagerbestände angezeigt worden, obwohl das Produkt bereits ausverkauft gewesen sei. Der Versuch, das Produkt manuell aus dem System herauszunehmen, sei nicht gelungen.
- Auf Antrag der Verfügungsklägerin hat das Landgericht Flensburg der Verfügungsbeklagten im Beschlusswege verboten, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland Parfümerie-Produkte der Marke der Verfügungsklägerin zum Kauf anzubieten und/oder hierfür zu werben, wenn das jeweilige Produkt nicht vorgehalten werde.
- Auf den Widerspruch der Verfügungsbeklagten gegen die einstweilige Verfügung haben die Parteien über die Sache mündlich verhandelt und das Landgericht Flensburg hat die im Beschlusswege ergangene einstweilige Bestätigung durch Urteil bekräftigt. Das Landgericht Flensburg hat zur Urteilsbegründung ausgeführt:
- Das an die Verbraucher gerichtete Angebot zum Kauf des Parfums sei eine geschäftliche Handlung der Verfügungsbeklagten gewesen. Dabei komme es nicht darauf an, ob die beim Angebot gemachte Angabe zum Lagerbestand nicht unmittelbar auf einem Verhalten einer Person beruht habe, sondern das Ergebnis eines automatisierten Prozesses gewesen sei. Auch der Einsatz eines automatisierten Warenwirtschaftssystems sei auf ein Verhalten einer Person zurückzuführen.
- Das Angebot der Verfügungsbeklagten sei bereits nach § 3 Abs. 3 i. V. m. Nr. 5 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG unzulässig. Unzulässig sei es insbesondere, wenn der Unternehmer nicht darüber aufkläre, dass er hinreichende Gründe für die Annahme habe, er werde nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen für einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen (Lockangebot).
- Danach sei nicht die nicht ausreichende Bevorratung mit einer Ware, sondern die unzureichende Aufklärung über eine unzureichende Bevorratung zu beanstanden. Die Verfügungsbeklagte habe nicht darüber aufgeklärt, dass sie die Ware nicht bereitstellen könne. Vielmehr verlautbarte das Angebot einen Warenbestand von drei Stück.
- Entgegen der Auffassung der Verfügungsbeklagten gehe es bei Nr. 5 des Anhangs nicht nur darum, die Gefahr der Umleitung von Kundenströmen zu bannen, die dadurch hervorgerufen werde, dass Verbraucher durch konkrete Angebote angelockt würden und sich dann mangels Verfügbarkeit für ein anderes Produkt entscheiden würden. Die Vorschrift solle auch die Enttäuschung von Verfügbarkeitserwartungen des Kunden sanktionieren. Der Verbraucher werde in dem Vertrauen geschützt, dass das beworbene Angebot in angemessener Menge und in einem angemessenen Zeitraum zur Verfügung stehe, sodass die zu erwartende Nachfrage befriedigt werden könne. Der Zweck des Verbots von Lockangeboten bestehe darin, dass der Verbraucher eine informierte, Verfügbarkeitsrisiken mit in den Blick nehmende Entscheidung treffen könne.
- Das gelte nicht nur für Platzkäufe im stationären Bereich, sondern auch für Internetangebote. Zwar bestehe beim Ladenkauf ein erhöhtes Risiko, weil ein vergeblicher Ladenbesuch intensiver sei als ein frustrierter Interneterwerb. Gleichwohl werde auch für die Internetrecherche Zeit investiert, die sich als vergeblich herausstellen könne.
Praxistipp: Die Ausführungen des Landgerichts Flensburg sind besonders relevant für Markenartikler mit einem selektiven Vertriebssystem – und für ihren Gegenpart, die Graumarkthändler. Graumarkthändler, die ohne sichere Bezugsquelle Markenprodukte anbieten wollen, müssen die Verbraucher über die Umstände und ggf. die Unsicherheiten ihrer Lieferfähigkeit angemessen informieren. Ist diese Information falsch oder irreführend, können Markenartikler dagegen vorgehen.
Gesetzgebung und Trends
Regierungsentwurf für Lieferkettengesetz vorgelegt
(Entwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten)
- Am 3. März 2021 hat die Bundesregierung den Entwurf des sog. Sorgfaltspflichtengesetzes vorgelegt – mit dem Ziel, dass der Bundestag es noch in dieser Legislaturperiode beschließt. Es soll dann ab 1. Januar 2023 für deutsche Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten gelten. Diese Schwelle soll ein Jahr später auf 1.000 Beschäftigte absinken.
- Nach dem Gesetzentwurf sind die Unternehmen verpflichtet, ihre Lieferketten laufend im Hinblick auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu prüfen und diese zu vermeiden. Dazu gehören u. a. die Einrichtung eines Risikomanagements, die Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen, das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen, die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens sowie Dokumentation und Berichterstattung.
- Für die behördliche Kontrolle und Durchsetzung ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zuständig. Es prüft die Berichte der Unternehmen und darf Geschäftsräume betreten und besichtigen sowie geschäftliche Unterlagen einsehen und prüfen. Unternehmen müssen dem BAFA auf Verlangen Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben. Bei Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten kann die Behörde eine Geldbuße bis zu EUR 800.000 verhängen. Bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als EUR 400 Mio. kann diese Geldbuße bis zu 2 % des Jahresumsatzes betragen. Überschreitet die Geldbuße bestimmte Grenzen, droht überdies der Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge für bis zu drei Jahre.
- Die zivilrechtliche Haftung der Unternehmen erwähnt der Gesetzentwurf nicht. Tritt das Gesetz in Kraft, besteht jedoch ein beachtliches Risiko einer Schadensersatzpflicht gegenüber Personen, deren Menschenrechte das Unternehmen durch den Verstoß gegen seine Sorgfaltspflichten verletzt hat.
- Am 10. März 2021 hat unterdessen das Europäische Parlament die Europäische Kommission aufgefordert, einen Gesetzentwurf über unternehmerische Sorgfaltspflichten vorzulegen, und einen eigenen detaillierten Entwurf einer Richtlinie beigefügt (Entschließung des Europäischen Parlaments zur Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen). Dieser Entwurf geht in mehrfacher Hinsicht über die Anforderungen des deutschen Entwurfs für ein Lieferkettengesetz hinaus.
Praxistipp: Direkt und indirekt betroffene Unternehmen sollten das deutsche und das europäische Gesetzgebungsverfahren verfolgen, um ggf. rechtzeitig mit den Vorbereitungen für die neuen Sorgfaltspflichten beginnen zu können. Es ist bereits jetzt ratsam zu prüfen, wie sich Informationen über menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken in den eigenen Lieferketten gewinnen und welche vorbeugenden Maßnahmen sich treffen lassen. Um den Aufwand gering zu halten, bietet es sich an, die neuen Anforderungen mit bereits bestehenden Compliance-Strukturen im Unternehmen zu verknüpfen, etwa mit der Prüfung von Geschäftspartnern und der Geldwäsche- und Korruptionsprävention. Angesichts des wachsenden Bewusstseins bei Verbrauchern und Investoren ist das nicht nur aus rechtlichen Gründen zu empfehlen, sondern auch zur Stärkung und Erhaltung der eigenen Reputation.
Das geplante deutsche Lieferkettengesetz und die damals absehbare Entschließung des Europäischen Parlaments haben wir in unserem Podcast zum Lieferkettengesetz näher beleuchtet. Zuvor hatten wir die Einigung unter den Bundesministern zu den wesentlichen Inhalten des Lieferkettengesetzes in einem Blogbeitrag analysiert. Menschenrechtliche Sorgfalts- und Berichtspflichten aufgrund ausländischer Gesetze haben wir in einem weiteren Blogbeitrag zusammengefasst.
Compliance Defense in der 10. GWB-Novelle
- Bei der Festsetzung der Höhe einer Kartell-Geldbuße kommen als abzuwägende Umstände insbesondere auch „vor der Zuwiderhandlung getroffene, angemessene und wirksame Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Zuwiderhandlungen“ in Betracht, § 81 d Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 GWB.
- Ferner kommen als abzuwägende Umstände insbesondere auch „nach der Zuwiderhandlung getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Zuwiderhandlungen“ in Betracht, § 81 d Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 GWB.
Praxistipp: Dass Compliance-Maßnahmen eines Unternehmens nach der Tat mildernd zu berücksichtigen sind, ist in der kartellrechtlichen Praxis schon bisher anerkannt. So hat zuletzt das OLG Düsseldorf mit unveröffentlichtem Urteil vom 11. September 2020 (Az. V 2 Kart 3 5/15 [OWi], referiert nach dem Fallbericht des Bundeskartellamts vom 5. März 2021) bei zwei Unternehmen bußgeldmindernd berücksichtigt, dass diese Unternehmen nach der Tat umfangreiche Compliance-Programme entwickelt und implementiert haben. Gleichzeitig hat es hervorgehoben, dass bloße Vertriebsschulungen noch kein wirksames Compliance-Programm darstellen.
Sehr umstritten ist bisher gewesen, inwieweit Compliance-Bemühungen vor der Tat eine Bußgeld-Reduktion rechtfertigen. Außerhalb des Kartellrechts hat der BGH in seinem Eufinger-Urteil vom 9. Mai 2017 (Az. 1 StR 265/16) herausgestellt, dass es für die Bemessung der Geldbuße von Bedeutung ist, inwieweit die Nebenbeteiligte ein effizientes Compliance-Management, das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt sein muss, installiert hat. Demgegenüber hat sich das Bundeskartellamt bisher von folgender Betrachtung leiten lassen: Gibt es ein effektives Compliance-Management-System, werden damit Verstöße von vornherein verhindert; kommt es zu Verstößen, war das System erwiesenermaßen nicht effektiv. Diese Haltung wird das Bundeskartellamt aufgrund der am 19. Januar 2021 in Kraft getretenen 10. GWB-Novelle (umfassend zu den Neuregelungen Kahlenberg / Rahlmeyer / Giese, BB 2021, 579, zu der entsprechenden Thematik im Entwurf des Verbandssanktionengesetzes) nicht mehr einnehmen können.
Abzuwarten bleibt, in welchem Ausmaß es zu einem „Compliance-Rabatt“ kommen wird. Für ein Settlement wird in aller Regel eine Bußgeldreduktion von 10 % gewährt. Das könnte es nahelegen, auch für ein Compliance-System eine entsprechende Reduktion vorzusehen, sicherlich abhängig davon, mit welcher Gründlichkeit ein solches System aufgesetzt und umgesetzt worden ist.
Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes: Unternehmen sollen künftig zur Errichtung eines Meldesystems verpflichtet sein
Nachdem in den letzten Jahren der Schutz von Hinweisgebern immer mehr Gegenstand politischer Diskussionen und von Gerichtsurteilen geworden ist, hat sich der europäische Gesetzgeber diesem Thema angenommen und im Jahr 2019 die Richtline zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (Richtline (EU) 2019/1937) verabschiedet, um europaweit einheitliche Standards für den Hinweisgeberschutz zu schaffen. Die Vorgaben der Richtlinie sind bis zum 17. Dezember 2021 in nationales Recht umzusetzen. Zu diesem Zweck hat nun das Bundesjustizministerium den Referentenentwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes ausgearbeitet, der kürzlich bekannt wurde. Sollte dieser Entwurf so umgesetzt werden, würde dies für viele Unternehmen deutliche Auswirkungen haben.
- Entsprechend der Vorgaben der Richtline ist nun vorgesehen, Unternehmen ab einer Größe von 50 Mitarbeitern, Kommunen ab einer Größe von 10.000 Einwohnern sowie Behörden zur Errichtung von Meldesystemen für Hinweisgeber zu verpflichten. Diese Meldesysteme sollen die Meldung von Verstößen gegen EU-Recht sowie von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ermöglichen. Für die Ausgestaltung dieser Meldesysteme stellt der Gesetzentwurf klare Anforderungen. So sollen Unternehmen künftig Hinweise über Gesetzesverstöße in mündlicher Form oder in Textform durch eine unabhängige Stelle entgegennehmen, Dokumentationspflichten nachkommen, Fristen für Rückmeldungen an den Hinweisgeber wahren und Folgemaßnahmen wie bspw. interne Untersuchungen einleiten. Dabei ist stets die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers zu wahren.
- Neben den unternehmensinternen Meldestellen sieht das geplante Gesetz die Einrichtung von externen Meldestellen durch Bund und Länder vor. Dabei soll es Hinweisgebern freistehen, ob sie ihre Meldung über die interne oder eine externe Meldestelle abgeben. Ein Vorrang für interne vor externen Meldungen besteht ausdrücklich nicht. Durch die Gleichstellung von internen und externen Meldewegen soll bewusst ein „Wettbewerb“ der Systeme geschaffen werden.
- Unabhängig vom gewählten Meldeweg (intern oder extern) dürfen gutgläubigen Hinweisgebern keine Nachteile erwachsen. So sind jegliche Repressalien, wie bspw. Kündigungen oder Nichtbeförderungen, im Zusammenhang mit der Meldung von Verstößen untersagt.
Praxistipp: Für viele Unternehmen löst das zu erwartende Hinweisgeberschutzgesetz Handlungsbedarf aus. Unternehmen, die bislang noch gar kein Hinweisgebersystem installiert haben, werden sich nun erstmals mit der Einrichtung entsprechender Meldekanäle befassen müssen. Unternehmen, die bereits über ein Hinweisgebersystem verfügen, werden prüfen müssen, ob dieses auch künftig den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Zwar ist das Nichtbetreiben einer internen Meldestelle nach dem Entwurf nicht bußgeldbewehrt. Will man allerdings vermeiden, dass Beschäftigte festgestellte Auffälligkeiten direkt an die zuständigen Behörden melden, bleibt die Einrichtung einer internen Meldestelle unumgänglich. Daher dürfte es im Interesse der meisten Unternehmen liegen, ein möglichst attraktives Hinweisgebersystem aufzubauen. Denn nicht zuletzt gilt ein Hinweisgebersystem heute als integraler Bestandteil eines wirksamen Compliance-Management-Systems.
Mehr hierzu: CMS-Blog: Ruf doch mal an – das Hinweisgeberschutzgesetz soll kommen
Verbot des Inverkehrbringens von Einwegkunststoffprodukten ab Juli 2021
(Einwegkunststoffverbotsverordnung – EKWVerbotsV)
- Am 3. Juli 2021, dem EU-rechtlich vorgegebenen Datum, tritt die Einwegkunststoffverbotsverordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/904 (EU-Einwegkunststoffrichtlinie) in Kraft (siehe hierzu auch unseren Blogbeitrag Einwegkunststoffverbotsverordnung – Das Ende der Wegwerfgesellschaft). Ziele der in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen sind neben der Reduktion des Verbrauchs von bestimmten Einwegkunststoffprodukten und der besseren Bewirtschaftung von Kunststoff als Ressource auch die umfassende Begrenzung der Auswirkungen der Einwegkunststoffprodukte auf die Umwelt.
- Mit der EWKVerbotsV wurden zunächst die Artikel 5 und 14 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie inhaltlich 1 : 1 in nationales Recht umgesetzt. Dementsprechend wird gemäß § 3 der EWKVerbotsV das Inverkehrbringen der genannten Einwegkunststoffprodukte sowie von Produkten aus oxo-abbaubarem Kunststoff, der sich in besonders schwer zu entsorgende Mikropartikel zersetzt, verboten. Zu den verbotenen Einwegkunststoffprodukten zählen Wattestäbchen, Einmalbesteck und -teller, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff sowie To-go-Lebensmittelbehälter und -Getränkebecher aus Styropor. Schließlich ist vorgesehen, dass Verstöße gegen das Verbot Ordnungswidrigkeiten darstellen und mit Bußgeldern von jeweils bis zu EUR 100.000 bewehrt werden können.
- Einwegkunststoffprodukte werden als ein ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehendes Produkt definiert, das nicht konzipiert, entwickelt und in Verkehr gebracht wird, um während seiner Lebensdauer mehrere Produktkreisläufe zu durchlaufen, indem es zur Wiederbefüllung oder Wiederverwendung für den ursprünglichen Verwendungszweck an einen Hersteller zurückgegeben wird, § 3 Nr. 2 EWKVerbotsV. Gerade in der Anfangsphase ist bei teilweise aus Kunststoff bestehenden Produkten (bspw. bei kunststoffbeschichteten Produkten) jedoch mit Auslegungsschwierigkeiten bei der Frage zu rechnen, ob ein Einwegkunststoffprodukt gegeben ist. § 3 EWKVerbotsV unterscheidet im Übrigen nicht danach, ob die betreffenden Produkte als Verpackung oder Nichtverpackung in Verkehr gebracht werden. In den Anwendungsbereich der EWKVerbotsV fallende Verpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 VerpackG sind zukünftig nicht mehr verkehrsfähig.
Praxistipp: Die Verbote beziehen sich auf die erstmalige Bereitstellung auf dem deutschen Markt durch Hersteller und Importeure, aber bspw. auch durch Franchisegeber. Sofern noch nicht geschehen, sollten diese umgehend prüfen, inwiefern ihre Produkte von dem Verbot betroffen sind und Anpassungen und Alternativen erforderlich werden. Da die Abgabe und der Vertrieb bereits im Verkehr befindlicher betroffener Kunststoffprodukte zulässig bleiben, sind Händler keine direkten Adressaten der EWKVerbotsV. Gleichwohl sollten sie dem Risiko von etwaigen Lücken im Sortiment entgegenwirken und sich rechtzeitig um alternative Produkte und eine Sortimentsanpassung bemühen. Die Unternehmen haben auch die weiteren Rechtsakte zur Umsetzung der Einwegkunststoffrichtlinie zu beachten, wie bspw. die Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung (EWKKennzV). Danach ist ab dem 3. Juli 2021 u. a. auf bestimmten Produkten darauf hinzuweisen, dass sie Kunststoff enthalten und eine unsachgemäße Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Kennzeichnungspflicht betrifft Getränkebecher, kunststoffhaltige Tabakfilter, Hygieneeinlagen, Tampons, Tamponapplikatoren und Feuchttücher.
Die weitere Regulierung von Kunststoffprodukten wird auch zukünftig diskutiert werden. Die EU hat angekündigt, die Einwegkunststoffrichtlinie im Jahr 2027 zu überprüfen. Langfristig ist mit weiteren Produktverboten zu rechnen, der Substituierungsdruck auf Kunststoffprodukte wird zunehmen. Auch daher sollten spätestens jetzt Überlegungen und Entwicklungen zu Alternativprodukten vorangetrieben werden, auch um von der bereits bestehenden Verbrauchnachfrage im Hinblick auf nachhaltige Produkte zu profitieren.
Internationale Handelssachen: Hamburg und NRW wollen Deutschland als Gerichtsstandort für Wirtschaftsstreitigkeiten stärken
Am 26. März 2021 haben Hamburg und Nordrhein-Westfalen den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gerichte in Wirtschaftsstreitigkeiten in den Bundesrat eingebracht. Hiernach können die Bundesländer an den Oberlandesgerichten Senate für internationale Wirtschaftsstreitigkeiten mit einem Streitwert ab EUR 2 Mio. einrichten. Um Deutschland als internationalen Standort für Wirtschaftsstreitigkeiten zu stärken, erlaubt der Entwurf, das Verfahren in englischer Sprache zu führen, und sieht besondere Vorschriften zur Geheimhaltung vor. Inwiefern dieser Entwurf umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.