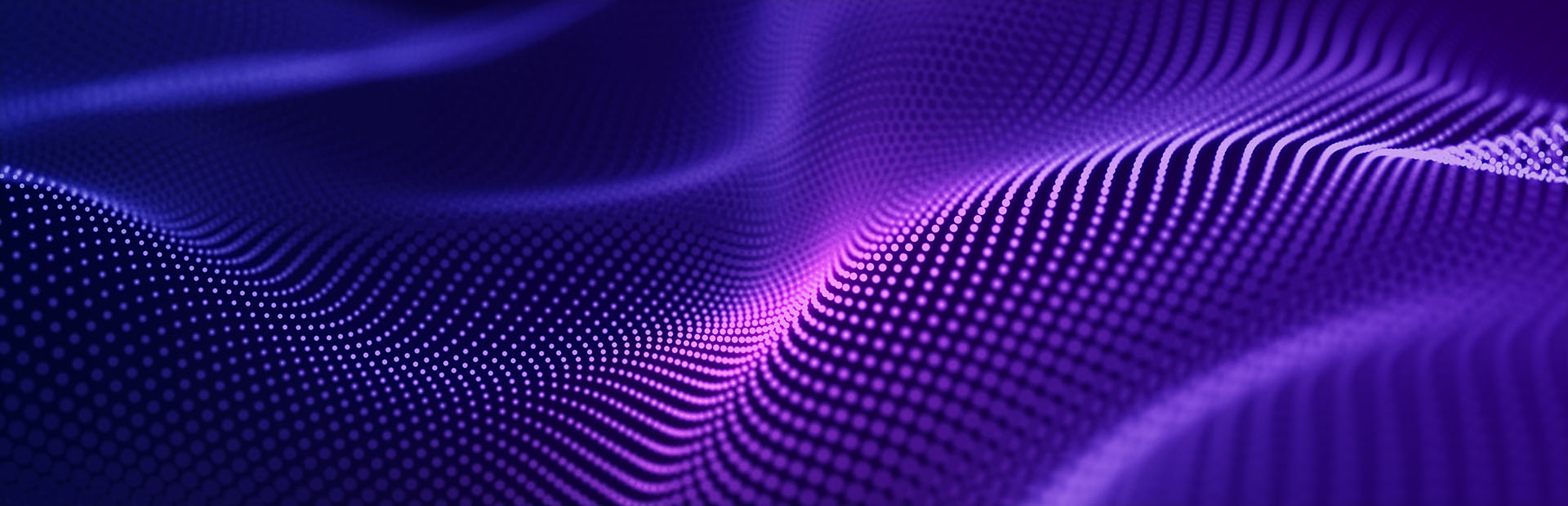Update Commercial 06/2024

Autoren
Ende Mai haben zwei wichtige EU-Gesetzgebungsverfahren für nachhaltigere Produkte und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft ihren Abschluss gefunden: Der Rat der EU hat sowohl die neue Ökodesign-Verordnung als auch die Richtlinie über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren, mit der ein EU-weites „Recht auf Reparatur“ eingeführt wird, final angenommen. Worauf sich Hersteller und Händler einstellen müssen, haben wir in dieser Ausgabe unseres Updates für Sie zusammengefasst.
Daneben informieren wir Sie unter anderem über zwei relevante Gerichtsentscheidungen für den Onlinehandel: Der EuGH hat entschieden, dass die Anforderungen an die Gestaltung des „Bestellbuttons“ auch bei bedingten Zahlungsverpflichtungen gelten und das OLG Karlsruhe hat ein Urteil zu unzulässigen Voreinstellungen im Bestellprozess gefällt.
Pünktlich zur Einstimmung auf die Finalrunde der EURO 2024 empfehlen wir auch unsere Blog-Serie „Fußball & Recht“, die sich mit Compliance-Themen rund um den Profisport im Allgemeinen und die Fußball-EM im Speziellen befasst.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Inhalt
Im Folgenden finden Sie die Themen des Newsletters.
Aktuelle Rechtsprechung
Anforderungen an „Bestellbutton“ gelten auch bei nur bedingter Zahlungsverpflichtung
Onlineshop darf kostenpflichtigen Expressversand nicht voreinstellen
Auch scheidende Handelsvertreter müssen sich weiter um Geschäftsabschlüsse bemühen
EUR 337,5 Mio. Geldbuße gegen Mondelez wegen Verstoßes gegen EU-Kartellrecht
Gesetzgebung und Trends
Ökodesign-Verordnung für nachhaltigere Produkte verabschiedet
Europäisches Recht auf Reparatur beschlossen
Registrierung nach REACH und EU-Sanktionsrecht im Spannungsverhältnis
EU-Lieferkettenrichtlinie auch vom EU-Rat bestätigt – CMS CSDDD Navigator unterstützt Sie beim Compliance-Health-Check
Bei Interesse können Sie das Update Commercial hier abonnieren.
Aktuelle Rechtsprechung
Anforderungen an „Bestellbutton“ gelten auch bei nur bedingter Zahlungsverpflichtung
(EuGH, Urteil v. 30. Mai 2024 – C-400/22)
- Unternehmer, die online mit Verbraucherinnen und Verbrauchern kostenpflichtige Verträge abschließen, sind nach der Verbraucherrechte-Richtlinie (2011/83/EU) EU-weit verpflichtet, den sog. Bestellbutton (die Schaltfläche, deren Betätigung die Zahlungsverpflichtung auslöst) gut lesbar mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer entsprechenden eindeutigen Formulierung zu kennzeichnen. Der EuGH hat nun klargestellt, dass dies auch dann gilt, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher erst nach Erfüllung einer weiteren Bedingung verpflichtet sind, das vereinbarte Entgelt an den Unternehmer zu zahlen.
- Die Verbraucherrechte-Richtlinie sehe im Hinblick auf die Anforderungen an den Bestellbutton keine Unterscheidung zwischen bedingten und unbedingten Zahlungsverpflichtungen vor. Die Informationspflicht entstehe daher bereits zu dem Zeitpunkt, zu dem sich die Verbraucherin oder der Verbraucher unwiderruflich damit einverstanden erkläre, im Fall des Eintritts einer von seinem Willen unabhängigen Bedingung an eine Zahlungsverpflichtung gebunden zu sein, auch wenn diese Bedingung noch nicht eingetreten sei.
- Eine andere Auslegung liefe dem Zweck der Vorschrift zuwider, die Aufmerksamkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Tatsache zu lenken, dass die Abgabe der Bestellung eine Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer zur Folge hat. Zudem würden Unternehmer so die Möglichkeit erhalten, sich ihrer Informationspflicht zu dem Zeitpunkt, zu dem noch auf die Bestellung verzichtet werden könnte, zu entledigen, indem sie in ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen Klauseln aufnehmen, die die Zahlungspflicht vom Eintritt objektiver Bedingungen abhängig machen, die nicht von einer Willenserklärung der Bestellenden abhängen.
Praxistipp: Der Bestellbutton beschäftigt regelmäßig die Gerichte und hat es nun bereits zum zweiten Mal vor den EuGH „geschafft“. Nachdem der EuGH sich 2022 bereits mit den Anforderungen an die Beschriftung des Buttons auseinandergesetzt hat (wir berichteten im Update Commercial 06/2022), besteht nun auch Klarheit darüber, dass die strengen Anforderungen auch dann gelten, wenn die Zahlungspflicht nicht unmittelbar durch das Anklicken des Buttons ausgelöst wird, sondern zunächst noch weitere Bedingungen eintreten müssen, die außerhalb des Verantwortungsbereichs der Bestellenden liegen. Verstöße gegen die Vorgaben führen dazu, dass der Vertrag nicht zustande kommt und die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher bereits geleistete Zahlungen zurückfordern können. Online-Anbieter sollten sich dessen bewusst sein und bei der Gestaltung des Bestellvorgangs entsprechende Sorgfalt walten lassen.
Onlineshop darf kostenpflichtigen Expressversand nicht voreinstellen
(OLG Karlsruhe, Urteil v. 26. März 2024 – 14 U 134/23)
- Onlinehändler, die für ihre Produkte optional einen kostenpflichtigen Expressversand anbieten, dürfen diese Option im Bestellprozess nicht über eine Opt-Out-Gestaltung in Form eines abwählbaren Häkchens voreinstellen.
- § 312a Abs. 3 BGB sieht vor, dass im B2C-Verkehr Vereinbarungen, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung der Verbraucherin oder des Verbrauchers gerichtet sind, nur ausdrücklich getroffen werden können und insbesondere im Onlinehandel nicht durch entsprechende Voreinstellungen herbeigeführt werden dürfen. Das OLG Karlsruhe hat diesbezüglich in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass darunter alle Zusatzleistungen fallen, die für die Erbringung der Hauptleistung nicht zwingend erforderlich sind, sondern diese ergänzen und das Leistungsspektrum des Unternehmers erweitern. Abzugrenzen seien solche Zusatzleistungen von Wahlmöglichkeiten der Verbraucherinnen und Verbraucher, durch die die vertragliche Hauptleistung überhaupt erst konkretisiert werde, wie beispielsweise die Größe oder Farbe eines Kleidungsstücks oder der Leistungsinhalt eines Mobilfunktarifs.
- Bei dem Aufpreis für die Expresslieferung handele es sich um ein Entgelt für ein zusätzliches Angebot und nicht um einen Teil der vereinbarten Hauptleistung. Die Kundinnen und Kunden müssten das Häkchen für den kostenpflichtigen Expressversand daher selbst aktiv setzen, urteilte das Gericht.
Praxistipp: Das OLG Karlsruhe konkretisiert mit der Entscheidung die Abgrenzung zwischen der vertraglich geschuldeten Hauptleistung und optionalen Zusatzleistungen, bei denen eine automatische Voreinstellung unzulässig ist. Dabei stellt das Gericht klar, dass diese Abgrenzung unabhängig davon erfolgt, ob die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Zusatzleistung (hier: die „Expressfähigkeit“ der Produkte) im Angebot ausdrücklich hervorgehoben wird. Sämtliche Leistungen, die nicht zwingend für die Erbringung der vertraglichen Hauptleistung erforderlich sind, sondern zu dieser hinzutreten, müssen von den Kundinnen und Kunden aktiv ausgewählt werden, um einen entsprechenden Zahlungsanspruch zu begründen.
Auch scheidende Handelsvertreter müssen sich weiter um Geschäftsabschlüsse bemühen
(OLG Köln, Urteil v. 22. September 2023 - 19 U 150/22)
- Handelsvertreter sind im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, sich um die Vermittlung oder den Abschluss von Geschäften zu bemühen und dabei die Interessen des Unternehmers wahrzunehmen (§ 86 Abs. 1 Hs. 1 HGB). Diese Bemühenspflicht besteht auch nach einer Kündigung des Handelsvertretervertrags bis zum Ablauf der Kündigungsfrist fort, hat das OLG Köln in einer Entscheidung aus September 2023 klargestellt. Bemüht sich der Handelsvertreter während der laufenden Kündigungsfrist nicht mehr ausreichend um die Vermittlung oder den Abschluss neuer Geschäfte, kann dies einen Schadenersatzanspruch des Prinzipals begründen.
- Eine derartige Verletzung der Bemühenspflicht muss dabei grundsätzlich der Prinzipal nachweisen. Kann dieser aber einen erheblichen Einbruch der vermittelten Geschäfte im Zeitraum nach der Kündigung im Vergleich zu den erreichten Abschlüssen im Vergleichszeitraum davor belegen, muss der Handelsvertreter darlegen, warum dieser Rückgang auf anderen Umständen als auf einer Einschränkung seiner Tätigkeiten beruht.
- Da dem Handelsvertreter dies im vom OLG Köln zu entscheidenden Fall nicht gelungen war, bejahte das Gericht einen Schadenersatzanspruch des Prinzipals. Dabei betonte das Gericht jedoch, dass zur Ermittlung der Schadenshöhe nicht ohne weiteres auf die Differenz zu den im Vergleichszeitraum erzielten Vertragsabschlüssen abgestellt werden könne, da der jeweilige Tätigkeitsumfang, den ein Handelsvertreter zur ordnungsgemäßen Pflichterfüllung aufwenden muss, nicht starr festgelegt werden könne, sondern sich in einer gewissen Bandbreite bewege. Da der mit der Tätigkeit erzielte Erfolg des Handelsvertreters auch auf einem überobligatorischen Einsatz beruhen oder - zumindest zum Teil - glücklichen Umständen geschuldet sein könne, könne bei Feststellung einer Pflichtverletzung nicht jede Abweichung nach unten bereits einen Schaden des Unternehmers darstellen. Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, hielt das OLG im konkreten Fall einen Abschlag von 30% für angemessen.
Praxistipp: Handelsvertreter sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihre Bemühenspflicht mit einer (fristgebundenen) Kündigung nicht erlischt, sondern – unabhängig von den Umständen, die zu der Kündigung geführt haben – bis zum Ablauf der Kündigungsfrist fortbesteht. Kündigt der Unternehmer den Vertrag mit dem Handelsvertreter, kann es sich gegebenenfalls empfehlen, bereits in der Kündigung auf den Fortbestand der vertraglichen Verpflichtungen und eine mögliche Schadenersatzpflicht bei Verletzungen hinzuweisen. Sollte es infolge der Kündigung dennoch zu Einbrüchen der Geschäftsabschlüsse kommen, die auf eine Verletzung der Bemühenspflicht hindeuten, sollten Unternehmer darauf achten, zum Nachweis der hierdurch entstandenen Schäden geeignete Vergleichszeiträume heranzuziehen.
EUR 337,5 Mio. Geldbuße gegen Mondelez wegen Verstoßes gegen EU-Kartellrecht
(Pressemitteilung der EU-Kommission v. 23. Mai 2024)
- Die Europäische Kommission hat am 23. Mai 2024 gegen Mondelez, einen großen Hersteller von Schokoladen- und Kekserzeugnissen, eine Geldbuße in Höhe von EUR 337,5 Millionen wegen Verstößen gegen das EU-Wettbewerbsrecht verhängt. Der Fall betraf bestimmte Praktiken von Mondelez, den grenzüberschreitenden Handel in der EU durch wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen (Artikel 101 AEUV) sowie den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (Artikel 102 AEUV) einzuschränken.
- Zwischen 2006 und 2020 schränkte Mondelez nach Ansicht der EU-Kommission den grenzüberschreitenden Handel mit Schokolade, Keksen und Kaffee in der EU durch folgende Maßnahmen ein:
- Beschränkung der Gebiete oder Kunden, an die Großhändler Produkte weiterverkaufen durften;
- Festsetzung höherer Preise für Exporte im Vergleich zu Inlandsverkäufen;
- Beschränkung des Verkaufs an Kunden in anderen Mitgliedstaaten durch Alleinvertriebshändler ohne vorherige Genehmigung. - Von 2015 bis 2019 hat Mondelez nach Ansicht der EU-Kommission auch seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, indem Mondelez
- sich weigerte, einen Zwischenhändler in Deutschland zu beliefern, um den Weiterverkauf in Österreich, Belgien, Bulgarien und Rumänien zu verhindern;
- Lieferungen in die Niederlande einstellte, um Importe nach Belgien zu verhindern, wo die Preise höher waren. - Die Maßnahmen führten nach Auffassung der EU-Kommission zu einer effektiven Aufteilung des Binnenmarktes und verhinderten Preissenkungen in Ländern mit höheren Preisen, wodurch die Verbrauerinnen und Verbraucher in der EU durch künstlich hoch gehaltene Preise geschädigt würden.
Praxistipp: Der Fall Mondelez unterstreicht die Entschlossenheit der EU-Kommission, das Wettbewerbsrecht durchzusetzen, um die Integrität des Binnenmarktes zu schützen. Unternehmen sollten ihre Verträge und Geschäftspraktiken überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den grenzüberschreitenden Handel innerhalb der EU nicht einschränken, da selbst vermeintlich geringfügige Beschränkungen zu hohen Bußgeldern führen können. Proaktive Maßnahmen, wie regelmäßige Schulungen und Compliance-Audits können dabei helfen, potenzielle Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht zu erkennen und zu vermeiden.
Für weitere Informationen zu diesem Fall und zum EU-Wettbewerbsrecht siehe auch den Beitrag Violation of EU competition law: Commission fines Mondelez EUR 337.5m auf CMS Law-Now.
> zurück zur Übersicht
Gesetzgebung & Trends
Ökodesign-Verordnung für nachhaltigere Produkte verabschiedet
(Pressemitteilung des Rats der EU v. 27. Mai 2024)
- Die neue Ökodesign-Verordnung ist beschlossene Sache: Im Mai hat der Rat der EU die Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte, die die derzeit geltende Ökodesign-Richtlinie ablösen wird, final angenommen (wir berichteten im Update Commercial 04/2022 über den Verordnungsentwurf der EU-Kommission).
- Die Verordnung erweitert den Kreis der Produkte, für die künftig Ökodesign-Anforderungen festgelegt werden können, erheblich. Betroffen sind nicht mehr nur energieverbrauchsrelevante Produkte, sondern alle Arten von Produkten, abgesehen von wenigen Ausnahmen (wie z.B. Lebens-, Futter- und Arzneimittel oder Fahrzeuge). Die Anforderungen, die für diese Produkte unter dem neuen Verordnungsrahmen festgelegt werden können, beschränken sich folgerichtig nicht mehr auf die Energieeffizienz, sondern können sich beispielsweise auch auf Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Nachrüstbarkeit, Reparierbarkeit, Ressourceneffizienz oder Recyclingfähigkeit der Produkte oder ihren CO₂- oder Umweltfußabdruck beziehen. Die konkreten Vorgaben für die betroffenen Produkte ergeben sich dabei aus – schon bestehenden oder noch kommenden – delegierten Rechtsakten für die jeweiligen Produktgruppen.
- Neben den Anforderungen an die Produktgestaltung kommen auf die Hersteller auch gesteigerte Informationsanforderungen zu. Für alle regulierten Produkte soll ein digitaler Produktpass verpflichtend werden, über den alle relevanten Informationen über Nachhaltigkeitsaspekte der Produkte und ihren Lebenszyklus abrufbar sein müssen. Hierdurch sollen Verbraucherinnen und Verbraucher besser über die von den Produkten ausgehenden Umweltauswirkungen informiert werden und die Rückverfolgbarkeit erleichtert werden.
- Die Verordnung enthält zudem Maßnahmen zur Eindämmung der Vernichtung unverkaufter Verbraucherprodukte (u.a. Retourenvernichtungen), wie beispielsweise Offenlegungspflichten. Für nicht verkaufte Kleidung und Schuhe gilt (schrittweise gestaffelt nach Unternehmensgröße) ab 2026 ein Vernichtungsverbot, das auf weitere Produktgruppen ausgedehnt werden kann.
- Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, für Verstöße gegen die Ökodesign-Verordnung Sanktionen festzulegen, die mindestens Geldbußen und den zeitlich befristeten Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge umfassen. Zudem sieht die Verordnung vor, dass Hersteller und Importeure (sowie subsidiär auch Fulfilment-Dienstleister) Verbraucherinnen und Verbrauchern gegenüber unmittelbar haften, wenn diesen durch die Nichtkonformität eines Produkts mit den Ökodesign-Anforderungen ein Schaden entsteht.
- Die Ökodesign-Verordnung wird nun zeitnah im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden und tritt 20 Tage später in Kraft. Sie gilt ab diesem Zeitpunkt ohne weitere Übergangsphase unmittelbar in allen Mitgliedstaaten
Praxistipp: Die neue Ökodesign-Verordnung setzt den Rahmen für weitreichende Produktanforderungen für zahlreiche Produktgruppen. Damit wird das Thema Product Compliance für Hersteller auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsanforderungen immer wichtiger. Vor diesem Hintergrund ist ein aufmerksames Monitoring der regulatorischen Anforderungen zu empfehlen.
Europäisches Recht auf Reparatur beschlossen
(Pressemitteilung des Rats der EU v. 30. Mai 2024)
- Neben der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte, die die Herstellung reparierbarer Produkte fördern soll, und der kürzlich in Kraft getretenen „Empowering Consumers Directive“, die es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen soll, fundierte Kaufentscheidungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Produkten zu treffen (siehe hierzu zuletzt im Update Commercial 02/2024) hat auch ein drittes Gesetzgebungsverfahren zur Förderung eines nachhaltigeren Konsums seinen Abschluss gefunden: Der Rat der EU hat Ende Mai auch die Richtlinie über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren angenommen, mit der EU-weit ein „Recht auf Reparatur“ eingeführt wird (wir berichteten zuletzt im Update Commercial 12/2023 über das Gesetzgebungsverfahren).
- Ziel der Richtlinie ist es, die Reparatur defekter Verbraucherprodukte sowohl innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen als auch darüber hinaus zu fördern. Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung wird die Reparatur zwar – anders als noch im Kommissionsentwurf vorgesehen – keinen grundsätzlichen Vorrang vor einer Neulieferung erhalten. Bei einer Reparatur verlängert sich jedoch künftig die Gewährleistungsfrist um ein Jahr.
- Außerhalb der Gewährleistung werden Hersteller von Produkten, für die Ökodesign-Vorgaben zur Reparierbarkeit bestehen, verpflichtet, diese Produkte in dem dort festgelegten Umfang selbst oder durch Dritte „unentgeltlich oder zu einem angemessenen Preis“ zu reparieren. Praktiken, die die Reparatur von Produkten behindern, werden untersagt.
- Die Richtlinie tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft und muss von den Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden. Dazu gehört auch die Festlegung von Sanktionen für Verstöße gegen die Reparaturverpflichtung.
Praxistipp: Da das Recht auf Reparatur außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung nur für Produkte gelten wird, für die konkrete Ökodesign-Anforderungen im Hinblick auf die Reparierbarkeit bestehen, werden hiervon nach aktuellem Stand primär bestimmte Haushalts-Elektrogeräte (z.B. Waschmaschinen und Geschirrspüler, Kühlgeräte und Staubsauger), elektronische Displays, Datenspeicherungsvorrichtungen sowie Smartphones und Tablets betroffen sein. Es ist aber davon auszugehen, dass unter der kommenden Ökodesign-Verordnung künftig auch für zahlreiche weitere Produktgruppen entsprechende Vorgaben getroffen werden. Auch diesbezüglich empfiehlt sich eine regelmäßige Überprüfung der jeweiligen Produktanforderungen, um sich auf mögliche Veränderungen in diesem Bereich rechtzeitig einstellen zu können.
Registrierung nach REACH und EU-Sanktionsrecht im Spannungsverhältnis
Hersteller und Importeure von Chemikalien nach der REACH-Verordnung müssen auch mit Unternehmen in Staaten zusammenarbeiten, gegen die die EU-Sanktionen verhängt hat – ganz aktuell beispielsweise Russland. Dass dabei auch allein der nach der REACH-Verordnung erforderliche Austausch von Informationen eine sanktionierte Handlung darstellen kann, ist wenig bekannt und wird in der Praxis gerne einmal übersehen. Um dieses Spannungsverhältnis aufzulösen, hat der EU-Kommission klargestellt, dass das Sanktionsrecht der REACH-Verordnung als „lex specialis“ vorgeht.
Einzelheiten erfahren Sie in unserem Blogbeitrag Chemikalienrecht vs. Sanktionsrecht: Was bei der REACH-Registrierung mit Unternehmen in sanktionierten Staaten zu beachten ist.
EU-Lieferkettenrichtlinie auch vom EU-Rat bestätigt – CMS CSDDD Navigator unterstützt Sie beim Compliance-Health-Check
(Pressemitteilung des Rats der EU v. 24. Mai 2024)
- Nachdem das Europäische Parlament Ende April nach intensiven Diskussionen eine stark überarbeiteten Fassung der EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) verabschiedet hatte (wir berichteten im Update Commercial 04/2024), hat Ende Mai auch der Rat der EU den Kompromisstext zu den neuen Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit förmlich angenommen.
- Die Richtlinie wird nun im EU-Amtsblatt veröffentlicht und tritt zwanzig Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Anschließend haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, die Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Anzuwenden sind die neuen Regeln von den Unternehmen – nach Größe gestaffelt – ab Mitte 2027, 2028 bzw. 2029.
Praxistipp: Die CSDDD soll sicherstellen, dass Unternehmen, die in ihren Anwendungsbereich fallen, sich mit den potenziellen und tatsächlichen negativen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Menschenrechte befassen. Der kostenfreie CSDDD-Navigator von CMS kann Sie bei der Prüfung unterstützen, ob die CSDDD auf Ihr Unternehmen anwendbar ist und wie gut Ihr Unternehmen auf die Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie vorbereitet ist.