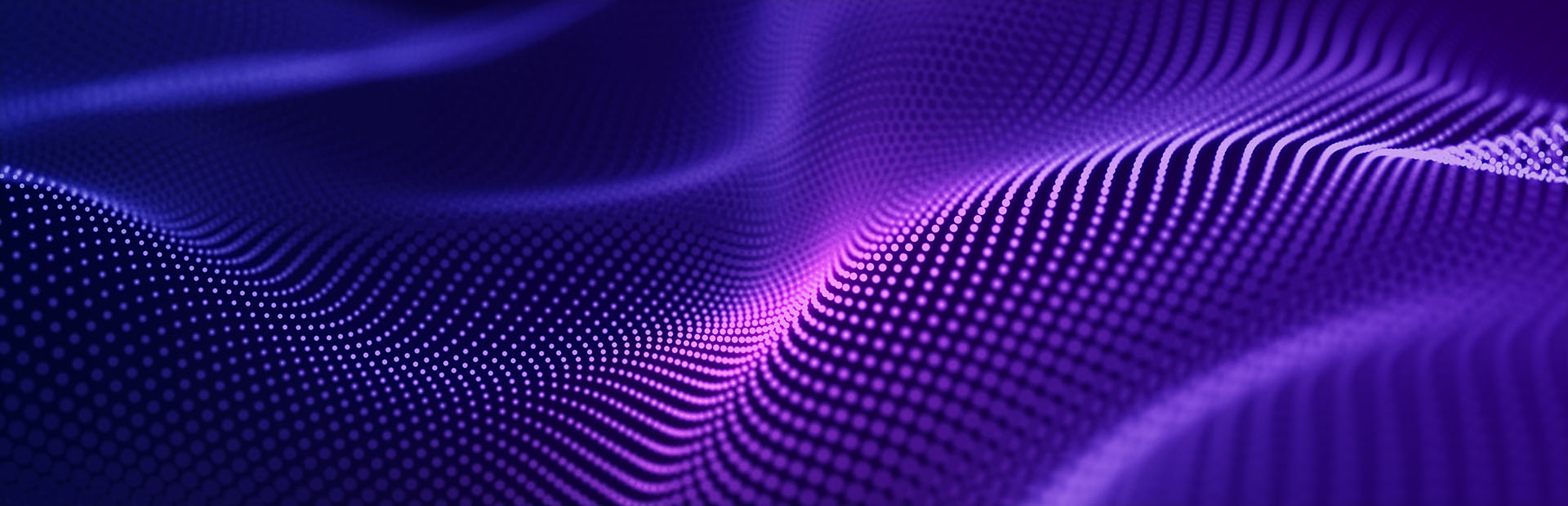Autorin
Am 18. April 2023 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) seinen Referentenentwurf für die Reform des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG-E) vorgelegt. Damit reagiert es auf Entscheidungen des EuGH vom 14. Mai 2019 (Az.: C-55/18) sowie des BAG vom 12. September 2022 (Az.: 1 ABR 22/21), die bei den Arbeitgebern für große Unsicherheit im Hinblick auf eine fehlerfreie Arbeitszeiterfassung gesorgt haben: Nachdem der EuGH in seiner sogenannten „Stechuhr-Entscheidung“ feststellte, dass die vorherige deutsche Rechtspraxis, nur Überstunden, nicht aber die reguläre Arbeitszeit zu erfassen, gegen die EU-Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG) verstoße, leitete das BAG in seiner vieldiskutierten Entscheidung eine allgemeine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung aus der arbeitsschutzrechtlichen Generalklausel des § 3 ArbSchG ab. Sollte der ArbZG-E in seiner jetzigen Fassung in Kraft treten, bedarf es dieses Rückgriffs nicht mehr.
Mehr zu der Historie erfahren Sie in unserem Blog und in unserem Podcast.
Pflicht zur elektronischen Erfassung noch am selben Tag
§ 16 Abs. 2 ArbZG-E begründet nun ausdrücklich die allgemeine Pflicht, Beginn, Ende und Dauer – und zwar alle drei Werte separat – der täglichen Arbeitszeit zu erfassen. Nicht aufzeichnungspflichtig sind Ruhe- und Pausenzeiten gemäß § 4 ArbZG. Ob Pausen eingehalten wurden, ist zwar aus den erfassten Werten über die tägliche Arbeitszeit ableitbar, die Lage und Anzahl der Pausen allerdings nicht.
Die Erfassung der Arbeitszeit muss grundsätzlich noch am selben Tag elektronisch erfolgen. Elektronisch sind beispielsweise Zeiterfassungsprogramme, Apps oder herkömmliche Tabellenkalkulationen; eine automatisierte Erfassung ist nicht nötig. Aufzeichnungen in anderer Form wie etwa auf Stundenzetteln werden nach einer Übergangsfrist nur noch für Kleinunternehmen mit bis zu zehn Arbeitnehmern (§ 16 Abs. 8 S. 3 ArbZG-E) oder bei entsprechender tarifvertraglicher Regelung (§ 16 Abs. 7 Nr. 1 ArbZG-E) zulässig sein. Die Aufbewahrungspflicht für die Aufzeichnungen beträgt grundsätzlich zwei Jahre (§ 16 Abs. 2 S. 3 ArbZG-E).
Erfasst werden muss die Arbeitszeit aller Arbeitnehmer. Dazu zählen gemäß § 2 Abs. 2 ArbZG auch Auszubildende, Praktikanten und Volontäre. Nicht umfasst sind hingegen die in § 18 ArbZG genannten Personengruppen, insbesondere leitende Angestellte und Chefärzte (nicht abschließend geklärt, wohl aber auch Geschäftsführer). Außerdem sollen Tarifparteien solche Arbeitnehmer ausschließen können, die nicht verpflichtet sind, zu festgesetzten Zeiten am Arbeitsplatz anwesend zu sein, sondern über den Umfang und die Einteilung ihrer Arbeitszeit selbst entscheiden können. Dazu zählen etwa Führungskräfte, herausgehobene Experten oder Wissenschaftler.
Vertrauensarbeitszeit bleibt möglich
Verantwortlich für die Erfassung der Arbeitszeit ist der Arbeitgeber. Er kann die Aufzeichnungspflicht zwar an die Arbeitnehmer oder an Dritte wie Vorgesetzte der Beschäftigten oder Entleiher von Leiharbeitnehmern delegieren (§ 16 Abs. 3 ArbZG-E). Dabei muss er aber eine ordnungsgemäße Umsetzung durch Kontrolle oder andere geeignete Maßnahmen, durch die ihm Verstöße bekannt werden, sicherstellen (§ 16 Abs. 4 ArbZG-E). Hierzu zählt beispielsweise die Meldung eines elektronischen Arbeitszeiterfassungssystems. Gegebenenfalls bedarf es zuvor einer Anleitung der Arbeitnehmer. Mit der Delegation wird der Arbeitgeber Vertrauensarbeitszeit umsetzen können.
Zu Anwendungsschwierigkeiten im Rahmen von mobilem Arbeiten wie etwa durch kurze Unterbrechungen der Arbeitszeit zu privaten Tätigkeiten oder – umgekehrt – durch kurze dienstliche Tätigkeiten nach Dienstschluss bietet der ArbZG-E hingegen keine Lösung.
Hinsichtlich der Erfassung von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft ist auf die durch die Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze zurückzugreifen: Ist der Arbeitnehmer verpflichtet, an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort physisch anwesend zu sein und sich dort für diesen in Bereitschaft zu halten (Bereitschaftsdienst), besteht eine Aufzeichnungspflicht nach dem ArbZG-E. Kann der Aufenthaltsort hingegen vom Arbeitnehmer selbst gewählt werden (Rufbereitschaft), muss die Zeit, in der er nicht zur Arbeit herangezogen wird, nicht erfasst werden.
Einführung von Sanktionen bei Verstößen gegen die Arbeitszeiterfassung
Bislang führen Verstöße des Arbeitgebers gegen die allgemeine Aufzeichnungspflicht nicht zu Geldbußen. Sollte § 22 Abs. 1 Nr. 9 ArbZG-E in Kraft treten, wird sich dies ändern: Wenn ein Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig Aufzeichnungen der Arbeitszeit nicht oder nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstellt, kann dies als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu EUR 30.000 geahndet werden (§ 22 Abs. 2 ArbZG-E).
Besteht aktuell Handlungsbedarf?
Obwohl die europäischen Vorgaben einen gewissen Handlungsspielraum für eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung – trotz Aufzeichnungspflicht – lassen, sieht alles danach aus, als würde sich durch den ArbZG-E inhaltlich wenig ändern. Arbeitgeber sollten aber im Hinblick auf die derzeitigen Planungen und das (künftige) Bußgeldrisiko – sofern nicht bereits geschehen – schon jetzt prüfen, wie eine Umstellung auf ein elektronisches Erfassungssystem umsetzbar ist. Tipps dazu finden Sie hier.
Kontakt
Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!