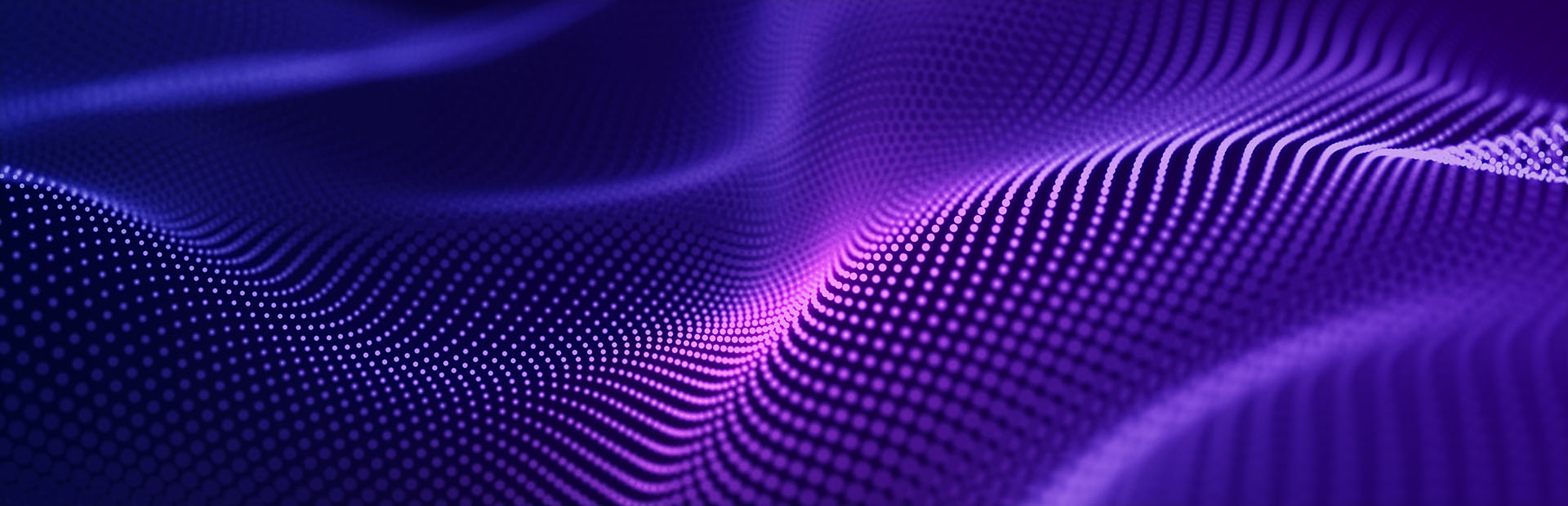Autor:innen
Seit Oktober 2023 hat Deutschland eine Abhilfeklage, mit der Verbraucherverbände Ansprüche von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie kleinen Unternehmen bündeln und in einer Kollektivklage gegen Unternehmen geltend machen können.
Neu ist, dass der klagende Verband direkt auf „Abhilfe“, also konkrete Leistungen, wie Schadenersatz, oder Reparatur, zugunsten betroffener Verbraucher und kleinen Unternehmen (max. zehn Beschäftigte mit Jahresumsatz/-bilanz von < EUR 2 Mio.) klagen kann. Damit geht die Abhilfeklage über die 2018 eingeführte Musterfeststellungsklage hinaus, bei der Verbraucherinnen und Verbraucher im Anschluss an das Musterfeststellungsverfahren individuell klagen müssen, um zum Beispiel Schadenersatz zu erhalten. Im Rahmen der Abhilfeklage werden die Verbraucheransprüche dagegen in einem Umsetzungsverfahren direkt erfüllt.
Phase 1: Klageerhebung bis Abhilfegrundurteil
Voraussetzung ist die Klageerhebung durch eine klageberechtigte Stelle. Dies sind vor allem die Verbraucherverbände, wie zum Beispiel Verbraucherzentralen. Der Verband muss im Klageantrag nicht – wie sonst im Zivilprozess – die Verbraucherinnen und Verbraucher, für die er klagt, konkret benennen. Ausreichend ist die Klageerhebung für eine nach bestimmten Merkmalen identifizierbare Gruppe, beispielsweise „alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Jahr 2023 einen bestimmten Vertrag geschlossen haben“. Da der klagende Verband nicht weiß, wie viele Verbraucherinnen und Verbraucher der Gruppe unterfallen und sich der Abhilfeklage anschließen werden, kann er die Zahlung eines „kollektiven Gesamtbetrags“ beantragen.
Die Abhilfeklage wird in einem Verbandsklageregister des Bundesamtes der Justiz öffentlich bekannt gemacht. Spätestens dadurch können Verbraucherinnen und Verbraucher von der Klage erfahren und sich ihr durch einfache, ohne Anwaltszwang mögliche und kostenfreie Anmeldung anschließen, wenn ihre Ansprüche dem Klageantrag unterfallen. Zu beachten ist die Anmeldefrist bis spätestens drei Wochen nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung.
Die erste Phase endet mit dem Abhilfegrundurteil. In diesem erklärt das Gericht die Klage dem Grunde nach für begründet oder es weist die Klage ab. Ist die Klage begründet, bestimmt das Gericht die konkreten Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung und zu erbringende Nachweise, zum Beispiel Vorlage des Kaufvertrags.
Phasen 2 und 3: Vergleichsphase bis Abhilfeendurteil
Als zweite Phase folgt die Vergleichsphase. Hier soll eruiert werden, ob eine gütliche Einigung möglich ist. Nachdem in diesem Verfahrensstadium die Haftung des Unternehmens dem Grunde nach bereits feststeht, sind hier vor allem Vergleiche über die Modalitäten der Abwicklung denkbar. Ein Vergleich muss vom Gericht genehmigt werden und bindet die angemeldeten Verbraucherinnen und Verbraucher, sofern sie nicht innerhalb eines Monats austreten.
Kommt kein Vergleich zustande, erlässt das Gericht in der dritten Phase das Abhilfeendurteil, das das Unternehmen zur Leistung verurteilt. Bei Klagen auf Zahlung eines kollektiven Gesamtbetrags kann das Gericht dessen Höhe schätzen. Dabei ist die Zahl der Anmeldungen im Verbandsklageregister zugrunde zu legen und mit der – ggfs. geschätzten, durchschnittlichen – individuellen Anspruchshöhe zu multiplizieren. Der Betrag ist vom Unternehmen zu Händen eines Sachwalters zu zahlen, der einen Umsetzungsfonds errichtet.
Erfüllung der Ansprüche im Umsetzungsverfahren
Im Umsetzungsverfahren prüft der gerichtlich bestellte Sachwalter erstmals die individuellen Ansprüche anhand der Kriterien des Abhilfegrundurteils. Ist das Ergebnis positiv, zahlt der Sachwalter die individuellen Beträge direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher aus dem Umsetzungsfonds aus. Ergibt sich, dass der ausgeurteilte kollektive Gesamtbetrag zu gering ist, um alle berechtigten Ansprüche zu erfüllen, kann das Unternehmen zu einem erhöhten kollektiven Gesamtbetrag verurteilt werden.
Abhilfeklage als neues „Klagetool“ für Verbraucherinnen und Verbraucher
Mit ihrem Klageziel auf Leistung ist die Abhilfeklage von der Konzeption effizienter als die Musterfeststellungsklage. Sie wird das „Klagetool“ sein, dessen sich Verbraucherschützer bedienen, wenn Pflichtverletzungen im Raum stehen, die eine Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern in gleichgelagerten Fällen betreffen. Wie attraktiv sie für Verbraucherinnen und Verbraucher selbst ist, muss sich allerdings noch zeigen. Sie brauchen aufgrund der Komplexität des Verfahrens in jedem Fall einen langen Atem, bis sie Leistungen erhalten. Möglicherweise ist für sie daher – obgleich nicht kostenfrei – der Weg über die Individualklage im Ergebnis leichter und effizienter. Ob daher mit Einführung der Abhilfeklage auch eine Entlastung der Justiz von der Vielzahl parallel geführter Individualklagen eintritt, bleibt abzuwarten.
Für Unternehmen im B2C-Geschäft steht dagegen fest: Durch die Abhilfeklage erhöht sich das Risiko der Inanspruchnahme in allen verbraucherrelevanten Bereichen, und zwar EU-weit. Denn: Die Einführung entsprechender Verbandsklagen auf Abhilfe in allen Mitgliedssaaten ist durch die EU-Verbandsklagenrichtlinie vorgegeben. Zudem drohen Reputationsschäden aufgrund der öffentlichkeitswirksamen Erhebung von Abhilfeklagen und der Berichterstattung dazu.
Kontakt
Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!